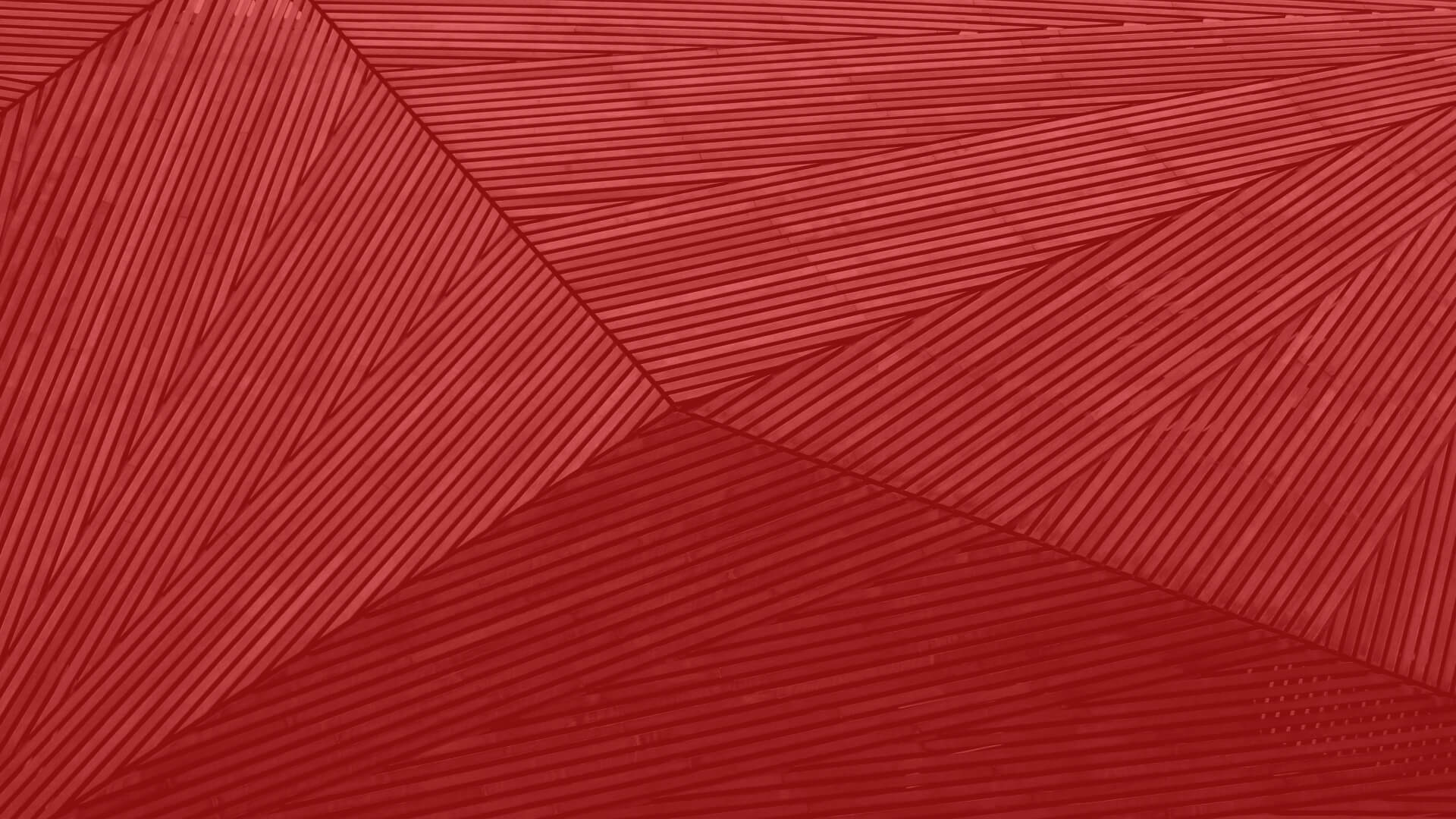In den letzten Jahren haben viele Kanzleien und juristische Institutionen ihre Websites, Social-Media-Kanäle und Imagebroschüren mit Schlagworten wie „Diversity“ und „Inklusion“ gefüllt. Bunte Teams, internationale Kollegen, Frauen in Führungspositionen – die Botschaft ist klar: Hier wird Vielfalt gelebt. Doch wie viel davon ist tatsächlich Realität und wie viel ist bloß ein Marketinginstrument? In einer Branche, die traditionell konservativ und hierarchisch strukturiert ist, lohnt ein kritischer Blick: Wie inklusiv ist die Jurabranche heute wirklich?
Doch was versteht man unter Diversity und Diversitätsmarketing?
Diversity bezieht sich auf die Vielfalt von Menschen, die in einer Organisation oder Gesellschaft leben, arbeiten oder interagieren. Dies umfasst Aspekte wie Geschlecht, Rasse, Ethnie, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Diversitätsmarketing ist hingegen die Strategie, diese Vielfalt zu nutzen, um die Marke oder Organisation zu stärken und zu profilieren. Es geht darum, die Vielfalt der Mitarbeitenden, Mandanten oder anderer Stakeholder zu betonen und zu nutzen, um eine positive Wahrnehmung und einen klaren Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
Grundsätzlich kann eine solche Marketingstrategie durchaus vorteilhaft für die Diversität sein. So wird das Thema sowohl im Betrieb als auch in der Allgemeinheit präsent. Dadurch können konkrete Schritte unternommen werden, um Diversität zu fördern und Diskriminierungen zu unterbinden.
Umgekehrt wird ein Konzept, das nur nach außen ein vielfältiges Bild durch Werbebilder oder Schlagworte vermitteln soll, der Diversität durch verschleierte Diskriminierung und Quotendenken schaden. Rein oberflächliche Maßnahmen erwecken im öffentlichen Raum den Eindruck, dass ein Problem gelöst sei, ohne dass dies tatsächlich der Fall ist. Debatten kommen zum Erliegen und strukturelle Herausforderungen bleiben bestehen.
Welche Folgen hat das Ignorieren von Diversitätsproblemen?
Ein zentrales Problem besteht im fehlenden Maß an Repräsentation. Wenn juristische Berufe und das Rechtssystem nicht vielfältig besetzt sind, bleiben bestimmte gesellschaftliche Gruppen unsichtbar. Dies führt dazu, dass ihre Erfahrungen und Bedürfnisse zu wenig Beachtung finden. Hinzu kommt ein Vertrauensproblem: Wenn Teile der Gesellschaft sich im Rechtssystem nicht wiederfinden, sinkt die Überzeugung, dass es fair und unparteiisch handelt.
Das Ignorieren von Diversitätsfragen schwächt zudem die Rechtsdurchsetzung. Ein homogenes Rechtssystem läuft Gefahr, Menschen ungleich zu behandeln und gerade marginalisierten Gruppen nicht den gleichen Zugang zu Recht und Gerechtigkeit zu ermöglichen.
Auch die Problemlösungskompetenz leidet unter mangelnder Vielfalt. Komplexe gesellschaftliche Herausforderungen lassen sich nur dann adäquat bewältigen, wenn unterschiedliche Perspektiven einbezogen werden. Schließlich bremst fehlende Diversität auch Innovation. Ohne neue Blickwinkel und Ansätze verpasst das Rechtssystem wichtige Impulse zur Weiterentwicklung.
Insgesamt zeigt sich: Diversität im juristischen Bereich ist unverzichtbar. Nur wenn alle gesellschaftlichen Gruppen sichtbar und gleichberechtigt vertreten sind, kann das Rechtssystem gerecht, wirksam und zukunftsfähig bleiben.
Welche klassischen Hindernisse stehen der Diversität in der Juristerei aktuell entgegen?
Die Jurabranche ist bekannt für ihre Tradition und Autorität, doch genau diese können eine vielfältige Gesellschaft gerade nicht wiederspiegeln. Während Vielfalt als Wert nach außen kommuniziert wird, zeigt sich im Inneren der Branche oft ein anderes Gesicht: Karrieren verlaufen entlang starrer Bahnen, Zugänge bleiben ungleich verteilt und das Versprechen von Chancengleichheit stößt an unsichtbare Grenzen. Wer verstehen will, warum die juristische Welt trotz zahlreicher Initiativen noch immer mit Homogenität ringt, muss einen Blick auf die strukturellen und kulturellen Hürden werfen, die den Weg zu echter Inklusion erschweren.
Rekrutierung – Bewährte Bildungswege und Notenfokus
Die juristische Branche in Deutschland ist seit jeher von einem stark standardisierten Rekrutierungssystem geprägt. Dieses System orientiert sich in erster Linie an traditionellen Karrierewegen und setzt nahezu ausschließlich auf Examensnoten als zentrales Auswahlkriterium. Dadurch entsteht ein strukturelles Nadelöhr, das den Zugang zu Großkanzleien und führenden Rechtsabteilungen massiv einschränkt.
Klassischer Bildungsweg als Selektionsmechanismus
Der Einstieg in renommierte Kanzleien verläuft meist entlang vorgezeichneter Bahnen: Studium an einer traditionsreichen Universität, Referendariat mit Station in einer Großkanzlei und anschließendem Prädikatsexamen. Absolventen, die diesen klassischen Weg verlassen – etwa durch längere Studienzeiten aufgrund von körperlichen, mentalen oder familiären Problemen – haben deutlich geringere Chancen, eine Anstellung zu finden.
Dieser klassische Bildungsweg ist für viele Recruiter ein Muss. Erwartet wird zudem oft ein LL.M. im Ausland oder ehrenamtliches Engagement. Solche Zusatzqualifikationen sind zwar wertvoll, setzen jedoch finanzielle Sicherheit oder gute Netzwerke voraus – die soziale Herkunft bleibt damit entscheidend.
Notenschnittfokus und Ausschlussmechanismen
Noch stärker als die Herkunftsuniversität oder Zusatzqualifikationen wirkt das Staatsexamen als Filter. Der Sprung in eine führende Kanzlei gelingt in der Regel nur mit einem Prädikatsexamen. Doch dieser Notenschnitt ist äußerst selten: Laut der Ausbildungsstatistik für die juristischen Prüfungen im Jahr 2023 erreichten nur etwa 21,3 % der Examenskandidaten diese Marke. Damit werden fast 80 % der Absolventen – unabhängig von anderen Kompetenzen wie Sprachkenntnissen, Auslandserfahrung oder sozialer Intelligenz – vom Bewerbungsprozess ausgeschlossen.
Diese Fixierung auf Noten birgt mehrere Probleme. Erstens misst das Staatsexamen in erster Linie Reproduktionsfähigkeit und juristische Dogmatik, nicht aber Verhandlungsgeschick, Teamarbeit oder Mandantenorientierung – Fähigkeiten, die im Berufsalltag entscheidend sind.
Zweitens wirkt die Notenfixierung sozial selektiv: So erzielen Studierende aus akademischen Haushalten deutlich häufiger überdurchschnittliche Ergebnisse, da sie Zugang zu besseren Netzwerken, Nachhilfeangeboten und finanzieller Absicherung während des Studiums haben. Sie müssen neben dem Studium meist keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, sodass sie sich häufiger auf ihre Studienleistungen konzentrieren können.
Anders bei Studierenden aus nicht-akademischen Haushalten, bei denen laut der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 51 % der Erwerbstätigen angeben, der Tätigkeit neben dem Studium nachzugehen, um den grundlegenden Lebensunterhalt finanzieren zu können. Doch diese finanzielle Sicherheit ist sogar bereits bei der Aufnahme eines Studiums entscheidend. So haben fast ⅔ der Jurastudierenden mindestens einen Elternteil, der selbst einen akademischen Hochschulabschluss erlangt hat, was meist mit einer finanziell besser gestellten Tätigkeit in Verbindung steht. Laut der kürzlich erhobenen Studie von Soziologe Asif Butt von der London School of Economy stammen sogar 85 % der Anwälte in Großkanzleien aus privilegierten Familien.
Auch die Möglichkeit BAföG-Bezüge zu erhalten, bringt vielen nur wenig finanzielle Sicherheit, da diese einerseits an die Regelstudienzeit geknüpft sind und andererseits die Verdienstgrenze der Eltern sehr niedrig gesetzt ist. Viele Eltern können ihren Kindern trotz ihres Willens kein Studium finanzieren, sodass diese wieder auf einen Nebenjob angewiesen sind.
Unconscious Bias – Unsichtbare Hürden im juristischen Karriereweg
Neben formalen Selektionsmechanismen wie Examensnoten prägen unbewusste Vorurteile – sogenannte unconscious bias – maßgeblich die Karrierechancen in der Jurabranche. Diese Vorurteile wirken subtil, sind oft unbeabsichtigt, entfalten aber erhebliche Wirkung bei Einstellungen, Beförderungen und der Zuweisung prestigeträchtiger Mandate.
Unconscious Bias im Recruitingprozess
Die Abhandlung „Implicit Bias: Scientific Foundations” von Greenwald und Krieger zeigt, dass Menschen dazu neigen, Bewerber zu bevorzugen, die ihnen selbst ähneln – sei es in Geschlecht, Herkunft oder Habitus. In der Praxis bedeutet das: Partner rekrutieren häufig Nachwuchsjuristen, die ähnliche Bildungs- und Lebenswege durchlaufen haben wie sie selbst. Vielfalt bleibt so eher eine Ausnahme als die Regel.
Problematisch daran ist vor allem, dass diese Vorurteile unbewusst sind und teils sogar den bewussten Überzeugungen entgegenstehen, da sie durch frühe Erfahrungen, emotionale Eindrücke und kulturelle Prägungen entstehen. Dabei stufen 69 % der Juristen laut einer internationalen Befragung von Paul Hastings und Bloomberg im Jahr 2016 unconscious bias als größte Hürde für Diversität in Kanzleien ein.
Zumindest ein kleiner Lichtblick: 90 % der Kanzleien erkennen laut dem Education Report der Zippo von 2025, dass unbewusste Vorurteile ihre Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen beeinflussen. Auch wenn diese Befragungen nicht national sind und deshalb nicht eins zu eins auf den Standort Deutschland übertragen werden können, so zeigen sie trotzdem, dass das Thema Diversität zumindest immer mehr Sichtbarkeit erlangt, auch auf der Führungsebene.
Frauenquote – Fortschritte mit Grenzen
Die Geschlechterfrage ist ein besonders sichtbares Feld unbewusster Vorurteile. Obwohl Frauen in Deutschland mehr als die Hälfte der Jurastudierenden ausmachen und auch auf der Associate-Ebene noch weiterhin 47 % weiblich sind, liegt ihr Anteil in Equity-Partnerschaften in den 20 umsatzstärksten deutschen Kanzleien laut der AllBright Stiftung bei lediglich 16 %. Auch unsere diesjährige Arbeitgeberumfrage konnte dieses Ergebnis bestätigen. So haben wir bei 40 befragten Großkanzleien einen Frauenanteil von 14,3 % auf der Ebene der Equity-Partnerschaft. Bei den Associates sind es hingegen noch 46,3 %.
Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass strukturelle Hindernisse und stereotype Zuschreibungen über den gesamten Karriereverlauf hinweg wirken. Studien wie die 2024 durchgeführte „Women in Economics: The Role of Gendered References at Entry in the Profession“ legen nahe, dass es nicht allein arbeitszeitbedingte Faktoren sind, die Frauen benachteiligen. Vielmehr spielen subtile Vorurteile und genderbezogene Erwartungen eine entscheidende Rolle: Frauen werden häufiger als weniger „durchsetzungsstark“ oder weniger „brillant“ eingeschätzt – Bewertungen, die insbesondere bei Beförderungsentscheidungen auf Führungsebene eine zentrale Rolle spielen.
Migrationshintergrund – Strukturelle Unterrepräsentanz
Ein weiteres Feld ist die ethnische Diversität. Laut Mikrozensus 2024 haben 30,7 % der Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. In der juristischen Branche spiegelt sich diese Realität jedoch kaum wider. Eine Studie zur Diversität in der deutschen Anwaltschaft von JUVE und LSE im Jahr 2022 ergab, dass rund 20 % der Juristen einen Migrationshintergrund haben – auf der Ebene der Partnerschaft sinkt der Anteil sogar auf 10 %. Damit wird wohl kaum der gesamtgesellschaftliche Durchschnitt widergespiegelt.
Auch hier spielen unconscious bias eine wichtige Rolle: Bewerber mit „fremd klingenden“ Namen erhalten beispielsweise seltener Einladungen zum Vorstellungsgespräch, wie Feldexperimente von Leo Kaas und Christian Manager 2012 im deutschen Arbeitsmarkt nachweisen. Selbst wenn formale Qualifikationen identisch sind, werden Kandidaten mit Migrationshintergrund systematisch benachteiligt.
Arbeitskultur und starre Karrierepfade – Strukturelle Belastungen und ungleiche Chancen
Die juristische Branche gilt als leistungsorientiert, statusbewusst und durch klare Hierarchien geprägt. Diese Kultur erzeugt eine Arbeitsrealität, die für viele Talente erhebliche Hürden aufbaut – insbesondere für Frauen und Personen mit familiären oder anderweitigen Care-Verpflichtungen. Lange Arbeitszeiten, Präsenzdruck und unflexible Karrierepfade sind zentrale Faktoren, die nicht nur Diversität behindern, sondern auch die Attraktivität des Berufsbildes insgesamt in Frage stellen.
Lange Arbeitszeiten und Präsenzkultur
Viele Kanzleien erwarten von ihren Associates eine überdurchschnittlich hohe Arbeitszeit. Diese wird insbesondere durch „billable hours“ bestimmt – also jene Stunden, die dem Mandanten in Rechnung gestellt werden können. In unserer Arbeitgeberumfrage haben wir auch nach diesen Zahlen gefragt. Überraschenderweise wurde ein vergleichsweise niedriger Durchschnittswert von 1.550 Stunden genannt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige Großkanzleien keine Angaben gemacht haben und Kanzleien sich bei solchen Umfragen häufig möglichst positiv darstellen. Die genannten Werte dürften daher eher den Mindesteinsatz der Associates widerspiegeln, sodass die tatsächliche Zahl vermutlich deutlich höher liegt.
Hinzu kommt, dass es sich bei diesen Angaben um das erste Berufsjahr handelt, während die Zahl der billable hours in späteren Jahren üblicherweise steigt. Außerdem ist ein erheblicher Teil des organisatorischen Aufwands nicht abrechenbar, und ein Bonus wird bei dem Mindestmaß von zu erbringenden billables in der Regel noch nicht gewährt.
Aufgrund dieser Faktoren arbeiten viele Berufseinsteiger bereits rund 50 Stunden pro Woche. Das deckt sich mit der Wahrnehmung vieler Juristen: Eine LTO-Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass rund 42 % der Befragten die „hohe Arbeitsbelastung“ als größten Nachteil des Berufs ansehen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass Präsenz im Büro weiterhin als sichtbarer Beleg für Leistungsbereitschaft gilt – auch in Zeiten digitaler Möglichkeiten. Homeoffice-Optionen oder flexible Modelle sind zwar durch die COVID-19-Pandemie verstärkt in den Fokus geraten, doch diese Angebote bleiben in Kanzleien oft auf einzelne Pilotprojekte beschränkt und wurden nach der Pandemie wieder abgebaut. Diese Präsenzkultur wirkt als unsichtbarer Selektionsmechanismus: Wer weniger sichtbar ist – etwa wegen Elternzeit, Teilzeit oder Homeoffice – wird implizit als weniger engagiert wahrgenommen, was sich negativ auf Beförderungschancen auswirkt.
Geringe Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die unflexible Arbeitsorganisation trifft besonders jene, die Betreuungsverantwortung übernehmen. Laut der Erhebung des statistischen Bundesamts im Jahr 2022 leisten Frauen in Deutschland im Durchschnitt 43,4 % mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer. In einem Umfeld, das nahezu totale Verfügbarkeit erwartet, sind sie daher strukturell benachteiligt.
Dies wird durch die bereits erwähnte Frauenquote auf der Ebene der Equity-Partnerschaft in Höhe von 14,3 % untermauert. Dieses „Leaky Pipeline“-Phänomen deutet klar darauf hin, dass nicht mangelnde Qualifikation, sondern strukturelle Hürden die Karriereentwicklung bremsen. Dabei muss man jedoch beachten, dass vermehrt – aber eben nicht nur – Frauen betroffen sind, sondern Personen jeden Geschlechts, die eine Betreuungsaufgabe innehaben – sei es durch Kinder oder auch erkrankte Angehörige.
Das traditionelle „Up-or-out“-Prinzip der Großkanzleien verlangt, dass Associates innerhalb weniger Jahre Partnerperspektive zeigen – oder das Haus verlassen. Wer in dieser Phase aufgrund von Familienpflichten nicht das volle Stundenpensum leisten kann, verliert häufig den Anschluss.
Damit wird ein homogenes Erfolgsprofil reproduziert: Männlich, ohne Care-Verpflichtungen, in Vollzeit verfügbar. Dieses System erschwert nicht nur Diversität, sondern verschärft auch den Fachkräftemangel, da qualifizierte Juristen mit anderen Lebensmodellen ausgeschlossen werden.
Physische und psychische Behinderungen – Barrieren im juristischen Berufsalltag
Diversität in der Anwaltschaft wird häufig mit Blick auf Geschlecht, Herkunft oder soziale Hintergründe diskutiert. Weniger Beachtung findet bislang die Situation von Juristen mit physischen oder psychischen Behinderungen. Dabei machen Menschen mit Behinderungen einen erheblichen Teil der Bevölkerung aus: Laut Statistischem Bundesamt lebten Ende 2023 rund 7,9 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung in Deutschland – das entspricht etwa 9,3 % der Gesamtbevölkerung. In der juristischen Branche jedoch sind sie kaum sichtbar, was auf tief verankerte strukturelle und kulturelle Hindernisse hinweist.
Strukturelle Barrieren für Menschen mit physischen Behinderungen
Anwaltskanzleien sind traditionell auf ein Vollzeit-Präsenzmodell ausgelegt. Mandatsarbeit erfordert oft kurzfristige Reisen, spontane Gerichtstermine und lange Arbeitstage. Für Juristen mit Mobilitätseinschränkungen oder chronischen Erkrankungen entstehen daraus erhebliche Zugangshürden.
So sind einige Justizgebäude immer noch nicht vollkommen barrierefrei. Selbst wenn die Kanzlei bei ihren Räumlichkeiten darauf achtet, dass beispielsweise genügend barrierefreie Parkplätze, abgesenkte Bordsteinkanten oder Aufzüge vorhanden sind, stehen Juristen mit physischen Behinderungen der Denkmalsschutz der alten Justizgebäude oder die langwierige öffentliche Umsetzung im Weg.
Unsichtbarkeit psychischer Erkrankungen
Neben physischen Einschränkungen spielen psychische Erkrankungen eine wachsende Rolle. Burnout, Depressionen und Angststörungen sind in hochkompetitiven Branchen weit verbreitet. Eine internationale Befragung der International Bar Association im Jahr 2021 zeigte, dass 41 % der befragten Juristen mit psychischen Belastungen Angst vor Stigmatisierung und vor negativen Folgen für ihre Karriere haben, wenn sie ihre Situation im Arbeitsverhältnis offenlegen.
In Deutschland ist die Lage ähnlich: Nach Daten der Bundespsychotherapeutenkammer aus dem Jahr 2023 sind psychische Erkrankungen in Deutschland mit 42 % inzwischen der häufigste Grund für Frühverrentungen. Gerade in der juristischen Branche, die durch Perfektionsanspruch, hohe Fallbelastung und langen Arbeitsdruck geprägt ist, wird dies zu einem erheblichen Hindernis.
Welche Maßnahmen unternehmen Anwaltskanzleien aktuell, um Diversität zu fördern?
In den letzten Jahren haben viele Kanzleien erkannt, dass Diversität nicht nur ein moralisches, sondern auch ein wirtschaftliches Anliegen ist: Auch die vierte Studie „Diversity matters even more“ von McKinsey zeigt, dass vielfältige Teams bessere Entscheidungen treffen und innovativer arbeiten. Entsprechend wurden zahlreiche Maßnahmen eingeführt, um Barrieren abzubauen, den Zugang zu erleichtern und die Unternehmenskultur inklusiver zu gestalten. Genau diese Maßnahmen macht auch unsere diesjährige Arbeitgeberumfrage sichtbar.
Strukturelle Verankerung – Konzepte, Komitees und HR-Trainings
Damit Diversität in der Jurabranche nicht bei wohlklingenden Absichtserklärungen stehen bleibt, muss sie strukturell verankert werden. Eine bloße Abfolge einzelner Projekte oder Marketingkampagnen reicht nicht aus, um die tief verankerten Mechanismen von Exklusion und Homogenität aufzubrechen.
Viele Kanzleien haben in den vergangenen Jahren daher umfassende Diversitätskonzepte entwickelt. Diese Konzepte definieren konkrete Ziele, zum Beispiel einen höheren Anteil von Frauen in der Partnerschaft, die Repräsentation von Juristen mit Migrationshintergrund oder die stärkere Integration von Menschen mit Behinderungen. Sie werden in der Regel von der Geschäftsführung verabschiedet und sind damit ein verbindlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Ein solches Konzept weist fast die Hälfte der befragten Anwaltskanzleien auf.
Ein zentrales Element der strukturellen Verankerung sind außerdem Diversitätskomitees oder eigens ernannte Diversity-Officers. Diese Gremien fungieren als Ansprechpartner für Mitarbeitende, treiben Initiativen aktiv voran und berichten direkt an die Kanzleiführung. Ihre interdisziplinäre Zusammensetzung – oftmals aus Partnern, Associates, HR-Vertretern und teilweise externen Experten – sorgt dafür, dass verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden. Eine solche Stelle haben sogar 55,75 % in ihrem Unternehmen eingeführt.
Auch die Personalabteilung spielt eine Schlüsselrolle. Durch gezielte Trainingsprogramme werden HR-Mitarbeitende und Führungskräfte darin geschult, unbewusste Vorurteile zu erkennen und diskriminierungsfreie Entscheidungsprozesse zu gestalten. Solche Schulungen werden bei 45,13 % der befragten Kanzleien durchgeführt. Dabei spielen vor allem Unconscious-Bias-Trainings eine große Rolle, um die Wahrnehmung für subtile Formen von Benachteiligung zu schärfen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass unconscious bias gerade unbewusste Vorurteile sind, auf die man zwar hinweisen kann, doch das tatsächliche Erkennen an der eigenen Person meist schwerfällt. Auf Grund dessen steht zwar fest, dass diese Maßnahme auf das Vorurteilsdenken aufmerksam macht, allerdings ist fraglich, inwieweit diese Methode – auch abhängig von der tatsächlichen Umsetzung – effektiv zur Bekämpfung dieser Vorurteile beitragen kann.
Ein anderer Ansatzpunkt könnte ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren sein. So kann man dem Abschlussbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes für das Pilotprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ entnehmen, dass solche Verfahren unbewusste Diskriminierung in der Auswahl reduzieren und insbesondere Talente aus unterrepräsentierten Gruppen einen erhöhten Zugang erhalten. Ergänzend kann die Beteiligung von mehreren HR-Personen an Auswahl- und Beförderungsprozessen als gegenseitige Kontrolle gegen unconscious bias wirken.
Monitoring und Evaluation – Von der Selbstverpflichtung zur echten Kontrolle
Die Förderung von Diversität ist nur dann wirksam, wenn ihre Fortschritte messbar sind. Viele Kanzleien haben deshalb in den letzten Jahren begonnen, ihre Bemühungen systematisch zu dokumentieren und in Form von Diversity-Reports zu veröffentlichen. Diese Berichte enthalten in der Regel Daten zu Geschlechterverteilung, Herkunft, Altersstruktur oder Beschäftigungsmodellen und werden jährlich aktualisiert. Der Vorteil solcher Reports liegt auf der Hand: Sie machen den Status quo transparent, schaffen eine Grundlage für Diskussionen und ermöglichen es, die Wirksamkeit von Programmen im Zeitverlauf zu überprüfen.
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die „Charta der Vielfalt“, eine bundesweite Initiative, der sich, Stand September 2025, bereits über 6.600 Unternehmen und Organisationen angeschlossen haben. Auch 21,12 % unserer befragten Kanzleien beteiligen sich an dieser Initiative. Mit der Unterzeichnung bekennen sie sich dazu, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist und allen Beschäftigten gleiche Chancen eröffnet. Viele Kanzleien nutzen diese Plattform nicht nur als öffentliches Bekenntnis, sondern auch, um auf Weiterbildungsangebote, E-Learning-Module oder Netzwerkevents zurückzugreifen, die von der Charta organisiert werden.
Gleichzeitig bleibt ein zentrales Problem bestehen: Die Unterzeichnung der Charta ist eine reine Selbstverpflichtung. Es gibt keine externe Kontrolle, die überprüft, ob die erklärten Ziele tatsächlich umgesetzt werden. Daher bleibt zu bemängeln, dass Unternehmen die Charta als reines Marketinginstrument nutzen könnten, ohne dass sich an der gelebten Praxis etwas ändert. Auch Diversity-Reports werden bislang meist von den Unternehmen selbst erstellt und unterliegen keiner unabhängigen Auditierung.
Eine konsequente Evaluation von Diversitätsprogrammen erfordert jedoch mehr als Selbstkontrolle. Externe Gutachten oder unabhängige Zertifizierungen könnten sicherstellen, dass die veröffentlichten Daten belastbar sind und dass Fortschritte nicht nur behauptet, sondern nachweisbar sind.
Damit Monitoring und Evaluation mehr sind als symbolische Akte, sollten Kanzleien ihre Berichte regelmäßig veröffentlichen, klare Kennzahlen definieren und diese mit Zielwerten hinterlegen. Nur wenn Fortschritte – oder Rückschritte – transparent dokumentiert und kritisch hinterfragt werden, kann ein echter Kulturwandel stattfinden. Die Kombination aus interner Selbstverpflichtung, externer Überprüfung und kontinuierlicher Weiterbildung schafft die Grundlage, um Diversität nicht nur zu versprechen, sondern tatsächlich umzusetzen.
Sichtbarkeit und Community-Building – Netzwerken als Motor
Diversität entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn sie im Arbeitsalltag sichtbar ist und aktiv gelebt wird. In der juristischen Branche kommt der Schaffung von Netzwerken und Gemeinschaften eine besondere Bedeutung zu. Sie dienen nicht nur dem Austausch und der gegenseitigen Unterstützung, sondern wirken auch nach außen, indem sie zeigen, dass unterschiedliche Identitäten und Lebensentwürfe in der Branche willkommen sind.
Viele Kanzleien organisieren mittlerweile regelmäßig Veranstaltungen, die gezielt Themen wie sexuelle Orientierung oder Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus rücken. Dazu gehören Pride-Events, Podiumsdiskussionen oder interne „Lunch & Learn“-Formate, in denen Mitarbeitende ihre Erfahrungen teilen können. Diese Events tragen dazu bei, Berührungsängste abzubauen, das Bewusstsein für unterschiedliche Lebensrealitäten zu schärfen und ein inklusives Arbeitsklima zu schaffen.
Parallel dazu entstehen immer mehr interne Netzwerke für Frauen und LGBTQ+-Juristen. Bei den befragten Kanzleien gaben 34,51 % an, dass in ihrem Unternehmen selbst ein Netzwerk für Minderheiten existiert. Solche Netzwerke bieten einen geschützten Raum für Austausch und Mentoring, stärken das Zugehörigkeitsgefühl und erleichtern es, Vorbilder sichtbar zu machen. Gerade in einer Branche, in der weibliche und queere Führungskräfte noch immer unterrepräsentiert sind, ist die Sichtbarkeit von Rollenvorbildern ein entscheidender Faktor für Nachwuchstalente. Zwar stimmt es, dass das Netzwerken in gemischten Gruppen einen stärkeren Einfluss auf die Karriereentwicklung hat, allerdings verkennt man dabei die mental unterstützende Wirkung solcher heterogenen Gruppen, die oft ähnliche Erfahrungen teilen. Neben konkreten Lösungsvorschlägen zu bestimmten Problemen, erhält man so vor allem das Gefühl der Verbundenheit, was das Wohlbefinden fördert.
Darüber hinaus fördern viele Kanzleien externe Organisationen, die sich für Gleichberechtigung und Inklusion einsetzen. Dies kann in Form von finanzieller Unterstützung, Pro-bono-Arbeit oder der Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Kampagnen geschehen. Durch die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen tragen Kanzleien dazu bei, strukturelle Barrieren auch außerhalb der eigenen Büros abzubauen – sei es durch den Zugang zu Rechtsberatung für marginalisierte Gruppen oder durch die Förderung von Forschung zu Diskriminierung und Chancengleichheit. Auf diese Weise wird nicht nur das eigene Engagement unterstrichen, sondern auch die gesellschaftliche Debatte über Vielfalt gestärkt.
Sichtbarkeit und Community-Building wirken damit auf mehreren Ebenen: Sie signalisieren nach innen, dass Diversität gewollt ist, und nach außen, dass Kanzleien gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Entscheidend ist jedoch, dass diese Initiativen nicht isoliert bleiben, sondern mit strukturellen Maßnahmen verknüpft werden. Erst das Zusammenspiel von symbolischer Sichtbarkeit und organisatorischer Veränderung kann einen nachhaltigen Kulturwandel in der Branche anstoßen.
Nachwuchsförderung und Talententwicklung – Frühzeitige Weichenstellung
Die Förderung des juristischen Nachwuchses ist ein entscheidender Hebel, um die Zusammensetzung der Branche langfristig diverser zu gestalten. Viele Kanzleien haben erkannt, dass sie Talente nicht erst bei der Bewerbung um eine Associate-Stelle ansprechen dürfen, sondern bereits in früheren Ausbildungsphasen aktiv werden müssen. Insbesondere Stipendien- und Mentoring-Programme spielen dabei eine zentrale Rolle, um strukturelle Zugangshürden zu überwinden.
Stipendienprogramme ermöglichen es Studierenden aus einkommensschwachen Familien oder mit Migrationshintergrund, ihr Studium ohne finanzielle Existenzsorgen zu absolvieren. In unserer Umfrage gaben jedoch nur 16,81 % an, eigene Stipendien für den Nachwuchs bereitzustellen. Dabei schaffen Stipendien eine Grundlage, auf der sich akademisches Potential entfalten kann. Gleichzeitig sind solche Programme häufig mit fachlicher Förderung verbunden, etwa in Form von Workshops, Moot Courts oder der Teilnahme an internationalen Konferenzen. Auf diese Weise erhalten Stipendiaten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Zugang zu Netzwerken, die sonst oft Absolventen elitärer Hochschulen vorbehalten sind.
Problematisch bleibt jedoch die Vergabe dieser Stipendien. So werden sie zwar an Studierende mit „schwierigen Einstiegsvoraussetzungen“ vergeben, allerdings sollen sie meistens trotzdem eine überdurchschnittliche Leistung aufweisen, die ja gerade durch die Hindernisse erschwert ist. Wer beispielsweise nach der Uni viel arbeiten oder sich um Angehörige kümmern muss, der kann in dieser Zeit nicht lernen und so gerade nicht die besten Noten schreiben. Durch diesen Notenfokus bringt das Stipendium leider nur wenigen echte Erleichterung. Stattdessen könnte man der Bewerbung Aufgaben hinzufügen, die ein generelles juristisches Verständnis und Vorgehen prüfen. Oder ein kurzes Praktikum als Vorauswahl-Kriterium gewähren, damit diese Personen die Möglichkeit haben, sich zu „bewähren“.
Mentoringprogramme wirken hingegen ergänzend und sind für die individuelle Karriereentwicklung besonders wirksam. Sie vernetzen Nachwuchsjuristen mit erfahrenen Partnern oder Senior Associates, die nicht nur fachlichen Rat geben, sondern auch Einblicke in Karrierepfade, Kanzleikultur und strategische Entscheidungen vermitteln. Studien verschiedenster Unternehmen – von Sun Microsystems zu Siemens bis hin zu Meta – zeigen, dass Mentees schneller befördert werden und seltener die Branche verlassen, weil sie sich besser eingebunden fühlen. Gerade für Frauen, die in der Partnerschaft noch immer unterrepräsentiert sind, können Mentoringbeziehungen entscheidend sein, um den Übergang von der Associate- zur Partner-Ebene erfolgreich zu meistern.
Außerdem unterstützen 59,29 % ehrenamtlich Projekte wie Moot Courts und immerhin 54,87 % fördern studentische Initiativen – finanziell oder durch kostenlose Vorträge und Seminare.
Ein weiterer Vorteil solcher Programme liegt in ihrer Signalwirkung: Kanzleien, die gezielt Nachwuchs fördern, zeigen, dass sie nicht nur kurzfristig nach Spitzenkandidaten suchen, sondern ein echtes Interesse an der Entwicklung von Talenten haben. Das stärkt die Arbeitgebermarke und macht die Branche für ein breiteres Spektrum an Bewerbern attraktiv.
Damit diese Maßnahmen nachhaltig wirken, müssen sie allerdings strategisch eingebettet werden. Ein einmaliges Stipendium oder ein loses Mentoringformat reicht nicht aus, um systemische Ungleichheiten zu überwinden. Erfolgreich sind Kanzleien, die ihre Nachwuchsförderung mit klaren Auswahlkriterien, messbaren Zielen und kontinuierlichem Monitoring verbinden. Erst wenn sichtbar wird, dass geförderte Talente auch tatsächlich in der Kanzlei Fuß fassen und aufsteigen, entfalten diese Programme ihr volles Potential für mehr Diversität.
Vereinbarkeit von Beruf und Care-Arbeit – Flexible Strukturen
Die Vereinbarkeit von beruflichen Anforderungen und Care-Arbeit ist eine zentrale Herausforderung in der juristischen Branche. Traditionelle Karrierepfade in Großkanzleien sind stark standardisiert: Der klassische Partner-Track setzt auf kontinuierliche Vollzeitverfügbarkeit, lange Präsenzzeiten und schnelle Aufstiegsschritte. Für Mitarbeitende mit familiären Verpflichtungen – sei es Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen – stellen diese starren Strukturen häufig ein erhebliches Hindernis dar.
Um dem entgegenzuwirken, haben zahlreiche Kanzleien alternative Karrierewege etabliert. Abweichungen vom typischen Partner-Track ermöglichen es, den Weg zur Partnerschaft flexibel zu gestalten. Mitarbeitende können ihre Karrierephasen an persönliche Lebensumstände anpassen, ohne dass dies automatisch als Karrierenachteil gewertet wird. So gaben 87,61 % an, dass Mitarbeitende bei ihnen die Partnerschaft auch in Teilzeit erreichen können. Auf diese Weise wird Diversität nicht nur ermöglicht, sondern aktiv gefördert, da Talente unabhängig von familiären Verpflichtungen Chancen auf Aufstieg erhalten.
Ein weiterer wichtiger Hebel ist mobiles und hybrides Arbeiten. Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle erlauben es Mitarbeitenden, Aufgaben ortsunabhängig zu erledigen und besser mit Betreuungsverpflichtungen zu vereinbaren. Wer nun jedoch denkt, dass durch die Pandemie flächendeckend 100 % Homeoffice möglich sei, der irrt. Nicht einmal ein Fünftel gibt an, dass ihre Associates vollständig aus dem Homeoffice arbeiten dürfen. Allerdings können in 91,15 % der Kanzleien die Rechtsanwälte mindestens an zwei Tagen die Woche im Homeoffice arbeiten.
Ergänzend setzen Kanzleien auf Teilzeit- und Jobsharing-Modelle, die insbesondere für Führungspositionen relevant sind. Auf diese Weise können Mandatsverantwortung und Führungsaufgaben aufgeteilt werden, sodass auch Mitarbeitende, die nicht in Vollzeit verfügbar sind, an anspruchsvollen Projekten und Entscheidungsprozessen teilhaben. Diese Modelle tragen wesentlich dazu bei, die sogenannte „Leaky Pipeline“ zu schließen, durch die vor allem Frauen nach der Familiengründung aus der Karriere ausgestiegen sind. Während Teilzeitarbeit auf allen Karrierestufen in bis zu 97,35 % der befragten Kanzleien akzeptiert ist, wird das Jobsharing nur in einem Fünftel toleriert.
Darüber hinaus bieten viele Kanzleien gezielte Unterstützungsprogramme an. Dazu gehören Zuschüsse oder direkte Angebote für Kinderbetreuung, Eltern-Kind-Büros innerhalb der Kanzlei oder Kooperationen mit Beratungsstellen und Pflegediensten. Solche Maßnahmen erleichtern den Mitarbeitenden die praktische Umsetzung von Care-Arbeit und verhindern, dass diese automatisch zu einem Karrierenachteil führt. So werden beispielsweise Eltern-Kind-Büros von einem Viertel der Befragten angeboten.
Insgesamt zeigt sich, dass die aktive Gestaltung flexibler Strukturen ein entscheidender Faktor für die Diversität in der Jurabranche ist. Wer Care-Arbeit nicht als individuelles Problem, sondern als organisatorische Herausforderung begreift, schafft ein Umfeld, in dem unterschiedliche Lebensrealitäten anerkannt und Talente unabhängig von familiären Verpflichtungen gefördert werden. Die Kombination aus alternativen Karrierepfaden, mobilen Arbeitsmodellen, Teilzeitlösungen und praktischen Unterstützungsprogrammen bildet dabei das Fundament für eine nachhaltige und inklusive Kanzleikultur.
Inklusion von Menschen mit Behinderung – Strukturelle und kulturelle Maßnahmen
Die Inklusion von Menschen mit physischen und psychischen Behinderungen ist in der juristischen Branche nach wie vor eine Herausforderung. Die hohe Leistungsdichte, lange Arbeitszeiten und Präsenzpflichten erschweren den Zugang zu Karrieren in Kanzleien, während klassische Karrierepfade wenig Flexibilität für unterschiedliche Bedürfnisse bieten. Um diese Barrieren zu überwinden, setzen immer mehr Kanzleien auf strukturelle Anpassungen und gezielte Inklusionsprojekte.
Ein zentraler Baustein ist die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden. Rollstuhlgerechte Zugänge, Aufzüge, barrierefreie Toiletten und Meetingräume sind inzwischen in vielen Großkanzleien Standard. Trotzdem haben in unserer Arbeitgeberumfrage lediglich 58,4 % angeben können, dass ihre Gebäude vollkommen barrierefrei sind. Dabei stellen diese baulichen Maßnahmen sicher, dass Mitarbeitende mit körperlichen Einschränkungen uneingeschränkt am Arbeitsalltag teilnehmen können. Gleichzeitig ist die barrierefreie Infrastruktur ein sichtbares Signal der Inklusion, das sowohl Mitarbeitende als auch Bewerber wahrnehmen.
Parallel dazu gewinnt mobiles und flexibles Arbeiten zunehmend an Bedeutung. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und ortsunabhängige Mandatsbearbeitung ermöglichen es Mitarbeitenden, ihre Aufgaben an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Dies gilt insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder temporären Einschränkungen, die sonst häufig benachteiligt wären. Flexible Arbeitsmodelle reduzieren nicht nur physische Barrieren, sondern fördern auch die psychische Gesundheit und die langfristige Bindung von Talenten an die Kanzlei.
Darüber hinaus implementieren Kanzleien zunehmend Inklusionsprojekte, die über die bauliche und organisatorische Anpassung hinausgehen. Dazu gehören interne Netzwerke für Mitarbeitende mit Behinderungen, Mentoringprogramme sowie Kooperationen mit externen Organisationen, die auf die Integration von Menschen mit Behinderungen spezialisiert sind. Solche Projekte fördern den Erfahrungsaustausch, schaffen Sichtbarkeit und helfen, stereotype Vorurteile abzubauen.
Die Kombination aus barrierefreien Strukturen, flexiblen Arbeitsmodellen und gezielten Inklusionsprojekten ermöglicht es Kanzleien, die Vielfalt ihrer Mitarbeitenden besser zu berücksichtigen und Talente zu halten, die sonst durch strukturelle Hindernisse ausgeschlossen wären. Gleichzeitig sendet die konsequente Umsetzung solcher Maßnahmen ein starkes Signal nach außen: Die Kanzlei nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst und fördert aktiv Chancengleichheit.
Förderung psychischer Gesundheit – Prävention und Resilienz in der Kanzleiarbeit
Psychische Gesundheit ist ein entscheidender Faktor für Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit und langfristige Bindung von Mitarbeitenden in der juristischen Branche.
Um dem entgegenzuwirken, implementieren Kanzleien zunehmend Maßnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit. Ein zentrales Instrument ist die Bereitstellung von zusätzlichem Urlaub. Mehr Urlaubstage, Vertrauensurlaub oder flexible Freistellungsregelungen ermöglichen es Mitarbeitenden, sich bewusst zu erholen, Belastungsspitzen abzufedern und die Work-Life-Balance zu verbessern. In unserer Arbeitgeberumfrage gaben über die Hälfte an, mehr als den gesetzlichen Mindesturlaub zu gewähren und insgesamt 79,65 % räumen Sonderurlaub für ihre Mitarbeitenden bei besonderen Anlässen wie der Geburt eines Kindes ein. In Kombination mit Sabbatical-Modellen, die 59,29 % unterstützen, lassen sich zudem längere Auszeiten realisieren, die sowohl der Regeneration als auch der persönlichen Weiterentwicklung dienen.
Darüber hinaus bieten viele Kanzleien Sport- und Präventionsangebote an. Yoga-, Fitness- oder Achtsamkeitskurse sowie Massagen fördern nicht nur körperliche Fitness, sondern helfen auch, Stress abzubauen und die mentale Resilienz zu stärken. Solche Angebote zur Stressreduzierung stellen sogar 87,61 % in unterschiedlichem Umfang zur Verfügung.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Förderung von mobilem und flexiblem Arbeiten. Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen Mitarbeitenden, ihre Arbeit an individuelle Bedürfnisse anzupassen, Belastungsspitzen zu vermeiden und familiäre oder private Verpflichtungen besser zu vereinbaren. Die Kombination aus orts- und zeitunabhängiger Arbeit mit klar definierten Erholungszeiten reduziert chronischen Stress und kann langfristig die psychische Gesundheit verbessern. Dazu zählt auch das Modell der Workation, das in 43,36 % der Kanzleien etabliert ist.
Durch diese Maßnahmen senden Kanzleien nicht nur ein klares Signal an ihre Mitarbeitenden, dass die psychische Gesundheit ernst genommen wird, sondern schaffen auch die Voraussetzungen für nachhaltige Leistungsfähigkeit. Die Integration von Urlaub, flexiblen Arbeitsmodellen, Sabbaticals und gesundheitsfördernden Angeboten ist daher ein zentraler Bestandteil einer modernen und inklusiven Kanzleikultur.
Fazit
Der Sektor hat in den vergangenen Jahren erhebliche Schritte unternommen, um Diversität und Inklusion zu stärken. Von Mentoring- und Stipendienprogrammen über Netzwerke für Frauen und LGBTQ+ bis hin zu flexiblen Arbeitsmodellen, barrierefreien Arbeitsplätzen und Angeboten zur Förderung psychischer Gesundheit – die Maßnahmenpalette ist breit und zeigt, dass Kanzleien das Thema zunehmend strategisch verankern. Die institutionelle Verankerung durch Diversitätskonzepte, Komitees und Trainingsmaßnahmen für HR und Führungskräfte schafft zudem die Grundlage dafür, dass Initiativen nicht nur symbolisch wirken, sondern in den Alltag integriert werden.
Trotz dieser Fortschritte bleibt der Weg zu echter Chancengleichheit und gelebter Diversität lang. Viele strukturelle Hindernisse bestehen weiterhin. Klassische Bildungswege, elitäre Netzwerke und die Unterpräsenz von marginalisierten Gruppen behindern nach wie vor. Auch unbewusste Vorurteile – unconscious bias – beeinflussen Bewerbungs- und Beförderungsentscheidungen.
Positiv ist jedoch, dass der Karriereweg nicht mehr streng dem „Up-or-out“-Prinzip folgt und auch Teilzeitmodelle im Partnertrack oder alternative Karrierestufen möglich sind.
Für eine nachhaltige Verbesserung gibt es noch weitere Ansatzpunkte, die aktuell noch nicht verfolgt werden. So könnten anonymisierte Bewerbungsverfahren – ergänzt durch die Beteiligung von mehreren HR-Personen – unbewusste Diskriminierung reduzieren.
Darüber hinaus sind externe Kontrollen mit klar definierten Kriterien notwendig, die optimalerweise auch Sanktionen erteilen. Schließlich können Bias-Effekte auch durch enge persönliche Beziehungen oder wiederholte positive Erfahrungen abgebaut werden, sodass Diversität nicht nur auf dem Papier, sondern auch im täglichen Miteinander gelebt wird.
Zusammenfassend ist Diversität ein ganzheitliches Thema, das nicht durch einen LGBTQ+-Day im Jahr gelöst wird. Auch wenn viele Kanzleien noch nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen, so gibt es auch einige Vorreiter, die sich für Inklusion stark machen. Das sind überwiegend diejenigen, die Diversitätsmarketing betreiben, sodass ihre Kampagnen eher den positiven Effekt des Marketings mitsichbringen. Selbstverständlich ist noch nicht jede unternommene Maßnahme effektiv. Allerdings kann oft erst durch die Umsetzung jener das Problem erkannt und Maßnahmen ergriffen werden.
Wie in der Gesellschaft ist auch in der Jurabranche die Kultur im Wandel, auch wenn der Weg zu echter Inklusion noch lang ist – ein bloßes Schlagwort ist Diversität nicht mehr!
Arbeitssuche leicht gemacht – so geht’s!
Highlights und Stellenangebote für dich…
Wir legen großen Wert darauf, dich in allen Phasen der juristischen Laufbahn bestmöglich zu begleiten. Daher findest du hier spezielle Empfehlungen, die sich an den unterschiedlichen Ausbildungsphasen orientieren: