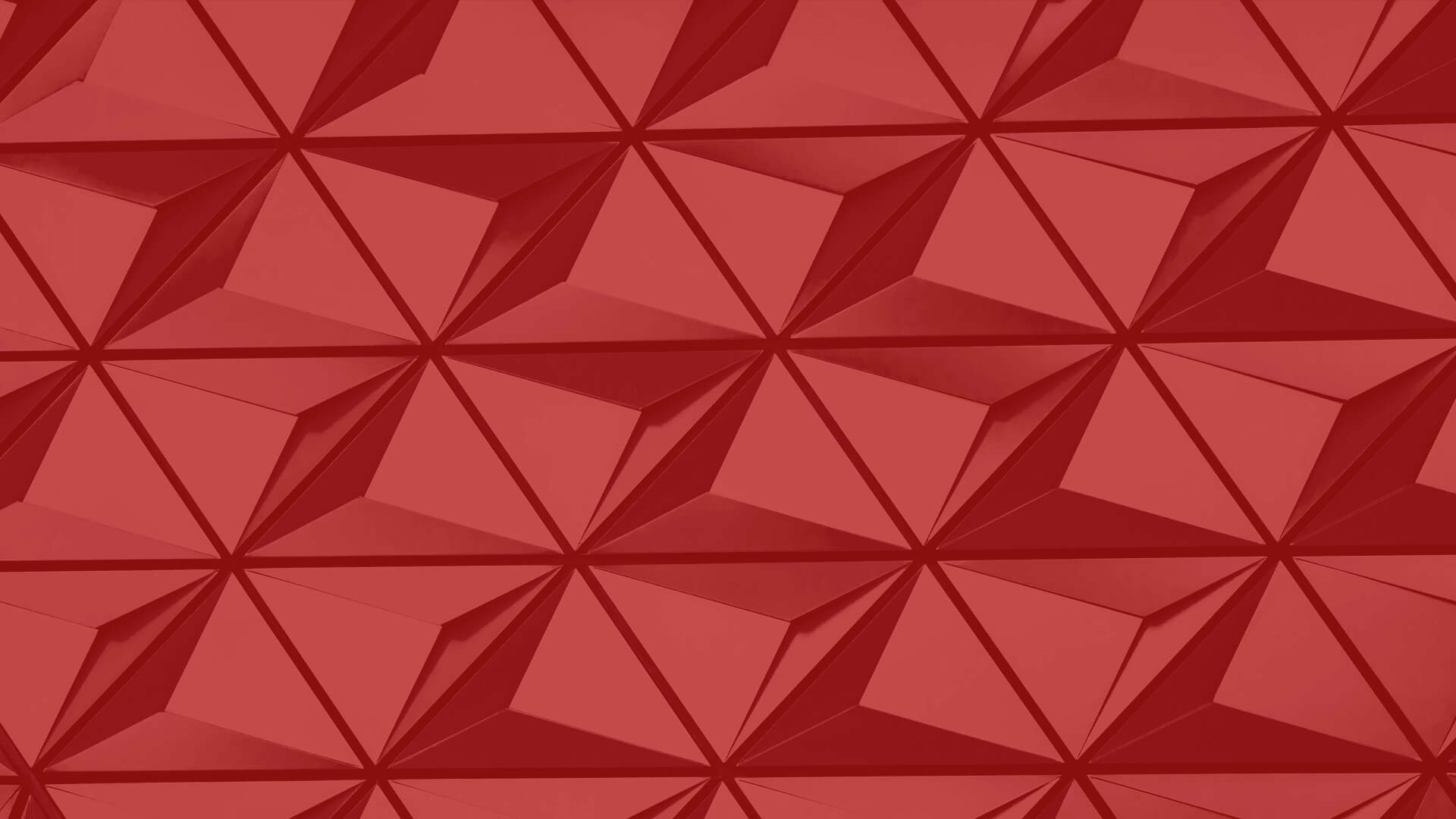Jura für Nicht-Muttersprachler – Hürde oder Sprungbrett?
Das juristische Studium ist eines der wenigen Fächer, in denen Vorwissen aus der Schulzeit wenig relevant ist. Gefragt sind keine Vorkenntnisse aus Mathe- oder Biologie-LK, von Nutzen sind allerdings sprachliches Geschick und logisches Denken. Bereits in den ersten Wochen des Studiums lernt man die deutsche Sprache als Werkzeug, Stilmittel und Basis des juristischen Arbeitens kennen. Wer gut formulieren kann und die Sprache für sich zu nutzen weiß, ist hier klar im Vorteil.
Doch wie gestaltet sich dies, wenn man nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist? Wenn man vielleicht erst zum Studium nach Deutschland kommt und sie neu erlernen muss? Wie schwer fällt es einem, im Gutachtenstil zu formulieren und wie stark ist der Konkurrenzdruck neben Muttersprachlern zu bestehen? Bei der zunehmend internationalen Ausrichtung von Kanzleien und dem stetig an Bedeutung gewinnenden Europarecht sind ausländische Studierende an deutschen juristischen Fakultäten schon länger keine Ausnahme mehr.
International ausgerichtete Studiengänge mit Doppelabschluss werden eingeführt und ein neuer Fokus über den Tellerrand der deutschen Grenzen hinaus erhält Einzug in die juristischen Fakultäten. Wir haben zu den Vorteilen und Schwierigkeiten des juristischen Studiums als Nichtmuttersprachler einen Studierenden europäischer Herkunft in Köln befragt, sowie Herrn Dr. Jan Kruse, Geschäftsführer des Zentrums für internationale Beziehungen der juristischen Fakultät in Köln.
Georgi Geshev ist 21 Jahre alt, er studiert im vierten Semester Jura auf Staatsexamen in Köln. Sein Abitur hat er in Bulgarien gemacht, wo er aufwuchs. Im Anschluss darauf zog er nach Deutschland, lernte Deutsch und immatrikulierte sich für Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. Mittlerweile lernt und spricht er seit zweieinhalb Jahren Deutsch.
Iurratio: Warum hast du dich für ein Studium entschieden, in dem die deutsche Sprache Haupthandwerkszeug ist?
Georgi: Ich war schon von Klein auf an der deutschen Sprache interessiert, meine Großmutter hat deutsche Philologie studiert und mir die deutsche Kultur näher gebracht. Meine Eltern haben Jura studiert, aber ich habe mich aus eigenem Antrieb für das Studium entschlossen, weil ich finde, dass jeder die Chance auf rechtlichen Beistand verdient. Seit der Kindheit liegt es mir am Herzen, Konflikte zu schlichten.
Iurratio: Hast du schon negative Erfahrungen gemacht oder hast du vielleicht Schwierigkeiten, Texte zu schreiben/ zu erfassen?
Georgi: Jeder Anfang ist schwierig, aber gerade im ersten Semester hatte ich Probleme. Nach sechs Wochen war die erste Klausur. Es ist schon sportlich, bis dahin den Gutachtenstil zu beherrschen, als Nichtmuttersprachler fast unmöglich. Mittlerweile bin ich aber mehr mit Deutsch und Jura vertraut und habe weniger Probleme.
Iurratio: Glaubst du, ein Muttersprachler hat dir gegenüber Vorteile im Studium?
Georgi: Für mich ist „Juristisch“ eine komplett neue Sprache, mit Fachtermini und Ausdrücken, die im Deutschen nicht immer gebräuchlich sind, daher denke ich nicht, dass ich einen großen Nachteil habe. Ich glaube aber, dass Muttersprachler einen zeitlichen Vorteil haben, weil sie Sachverhalte schneller erfassen können.
Iurratio: Denkst du, dass Jura dir hilft, schneller mit der deutschen Sprache vertraut zu werden?
Georgi: Auf jeden Fall, denn es kommt auf ein tägliches Auseinandersetzen mit der Sprache an. Ohne eine vernünftige Sprachkenntnis kann man keine Klausur bestehen. Daher ist man im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Studiengängen mit seinen Defiziten konfrontiert und kann an ihnen arbeiten.
Iurratio: Was oder wer hat dir geholfen, dich in deinem Studium und mit der Sprache sicherer zu fühlen?
Georgi: Ich hatte das Glück einer tollen Gastfamilie, die mir mit Sprache und Kultur geholfen hat. Seit Beginn meines Studiums engagiere ich mich außerdem in der Hochschule. Durch meine Arbeit in der Fachschaft habe ich Zugriff zu vielen hilfreichen Materialien und höheren Semestern, deren Tipps sehr wertvoll sind. Meine Tätigkeit im Studierendenparlament und in anderen Gremien hilft mir dabei, offen vor anderen zu sprechen und mich besser auszudrücken.
Iurratio: Würdest du dir zusätzliche Angebote an den Universitäten für Nichtmuttersprachler im Studium der Rechtswissenschaften wünschen?
Georgi: An meiner Uni gibt es Kurse wie Deutsch für Juristen und es wird viel gemacht, um ausländischen Studierenden den Einstieg zu erleichtern. Toll fände ich zu Beginn des Studiums zusätzliche kleine Veranstaltungen, in denen alles noch einmal erklärt wird, es ist schlicht nicht möglich, Infos über Prüfungsordnung und Stundenplan derart schnell aufzunehmen und die Hemmschwelle nachzufragen ist in einer riesigen Gruppe groß. Solche Veranstaltungen gibt es bisher schon für Programm- und ERASMUS- Studierende. Eine Ausweitung auf den Staatsexamensstudiengang wäre toll.
Herr Dr. Jan Kruse, Geschäftsführer des Zentrums für Internationale Beziehungen (ZIB) der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln, sieht sich täglich mit Studierenden nichtdeutscher Herkunft und deren Problemen konfrontiert. Das Zentrum für Internationale Beziehungen verwaltet die internationalen Studienprogramme
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät .
Sie sind zahlreich: u.a. die binationalen Bachelor- und Masterstudiengänge zum deutsch-französischen Recht mit Paris 1 Panthéon-Sorbonne, zum deutsch-türkischen Recht mit den Universitäten Istanbul Bilgi und Istanbul Kemerburgaz, zum deutsch-italienischen Recht mit der Universität Florenz, den Masterstudiengang Wirtschaftsrecht und den LL.M.- Studiengang zum deutschen Recht für ausländische Juristen, die Studien- und Praktikaprogramme in den USA, China, Georgien, Indien, Russland und Südkorea und die internationalen Studienaustauschprogramme mit über 50 europäischen Universitäts-Partnerschaften. In seiner Position berät er oft Studierende, die Anlaufprobleme mit ihrem Studium an der juristischen Fakultät haben.
Iurratio: Würden Sie sagen, der Anteil an Jurastudenten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ist hoch?
Dr. Kruse: Nein, das würde ich nicht sagen. Gerade im Staatsexamensstudiengang ist das eher die Ausnahme. Jedoch ist eine Internationalisierung zu erkennen, immer mehr Studiengänge mit binationaler Orientierung werden akkreditiert, so bieten wir beispielsweise Studienprogramme mit Frankreich, England, Italien und der Türkei an. Allerdings machen nur etwa 10 % z.B der französischen Teilnehmer des deutsch-französischen Studienganges nach Abschluss des LLB noch das deutsche Staatsexamen. Es bleibt also eher die Ausnahme, dass man Nichtmuttersprachler in Staatsexamensklausuren antrifft.
Iurratio: Mit welchen Problemen kommen ausländische Studierende für gewöhnlich zu Ihnen? Sind diese oft sprachspezifisch?
Dr. Kruse: Die meisten haben tatsächlich Probleme mit dem Denk- und Gutachtenstil der deutschen juristischen Falllösung. Häufig sind auch Schwierigkeiten mit dem Stundenplan. Leider kommen viele erst Mitte des ersten oder Anfang des zweiten Semesters zum ZIB, weil die Hemmschwelle, Hilfe zu erbitten,anscheinend hoch ist. Wir versuchen diese Hemmschwelle durch zwanglose Begrüßungs- und Informationsveranstaltungen zusammen mit unseren studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ZIB zu überwinden. Das gelingt uns, wie ich glaube, mittlerweile auch gut. So erkennen die ausländischen Studierenden besser, dass wir wissen, welche Probleme sie haben und sie uns deshalb immer gerne ansprechen können.
Iurratio: Sehen Sie die fremde Sprache als Hindernis?
Dr. Kruse: Ganz klar. Man steht unter einem ganz anderen Druck als ein Muttersprachler. Der hohe Zeitdruck und die enorme Materialfülle zur Lösung einer juristischen Klausur in Deutschland verlangen sehr gute sprachliche Kenntnisse, um diesem Streß gewachsen zu sein. Jede Unsicherheit in der fremden Sprache führt zu einem Verlust an Zeit, die dann bei der fachlichen Lösung des Falles fehlt.
Iurratio: Welche Möglichkeiten gibt es, ausländischen Studierenden zu helfen?
Dr. Kruse: Wir bieten in Köln beispielsweise zusätzliche Arbeitsgemeinschaften für ausländische Teilnehmer an, insbesondere für Erasmus- Studierende. Diese stehen aber auch anderen Nichtmuttersprachlern offen. Die Gruppen in diesen Arbeitsgemeinschaften sind kleiner als üblich, dadurch sinkt die Hemmschwelle, Fragen zu stellen. Die AG-Leiter können besser auf diespeziellen Bedürfnisse der einzelnen Studierenden eingehen.
In den Programmstudiengängen gibt es außerdem Tandembetreuung und Mentorenprogramme, um den Studieneinstieg zu erleichtern. Außerdem ist neben dem ZIB auch die allgemeine Studierendenberatung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, das Studien- und Beratungszentrum mit meiner Kollegin Frau Povedano-Peramoto, immer bereit und engagiert, bei Problemen zu helfen und eine individuelle Lösung zu finden.
Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die juristischen Fakultäten in Deutschland zunehmend von kultureller und sprachlicher Diversität geprägt sind.Das Jurastudium stellt an Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, besondere Herausforderungen, bietet allerdings auch neue Perspektiven und Chancen und erleichtert das Erlernen der neuen Sprache durch das tägliche Auseinandersetzen mit dieser.
Jeder Nichtdeutsche, der sich für dieses ohnehin schon anspruchsvolle Studienfach entscheidet, verdient den Respekt und die Unterstützung seiner Kommilitonen. Wenn ihr selbst Probleme mit der Sprache oder dem Einstieg in das Studium habt, erkundigt euch bei eurer Studienberatung nach spezifischen Angeboten an eurer Fakultät.