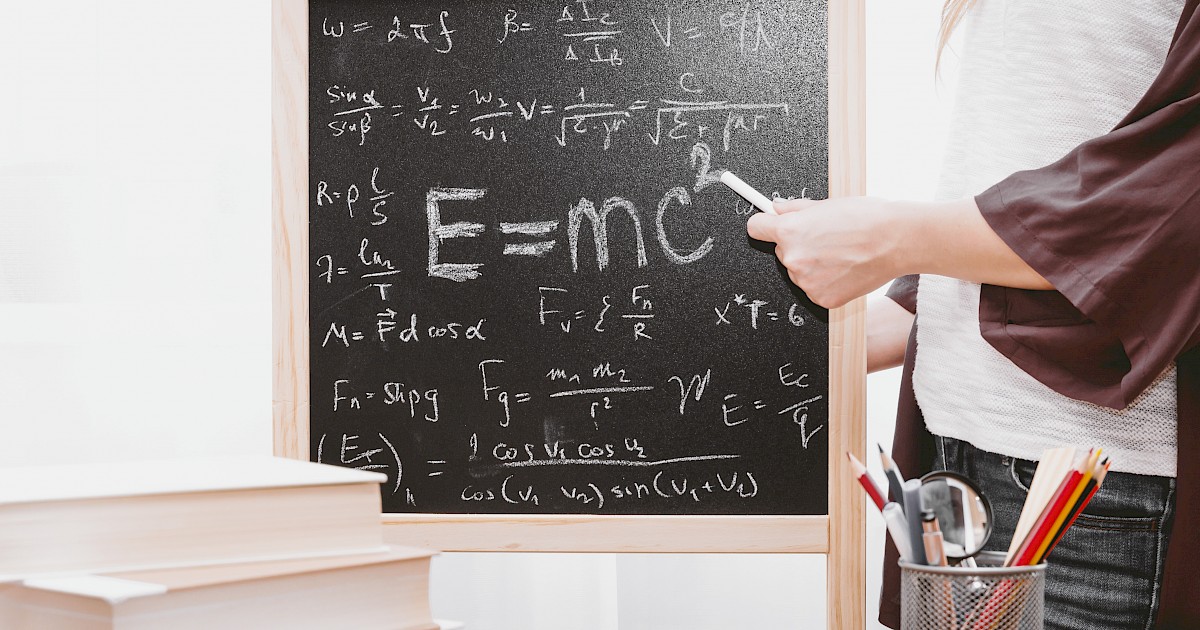Sachverhalt + Tatbestand ÷ Subsumtion = Rechtslage
Letztens lief mir mal wieder Charlotte über den Weg und fragte: „Warum wird eigentlich den Erstis Methodenlehre abverlangt? Das ist doch viel zu früh, da versteht doch keiner was. Wäre es nicht viel vernünftiger, so etwas im 5. oder 6. Fachsemester anzubieten? Oder vielleicht braucht man das ja auch gar nicht? Oder?“ Sie schaute mich bei diesem „oder“ etwas länger an und ich merkte, dass es ihr wirklich ernst war.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Familienrichterin, die mir auch sagte, sie verstünde die Ausbildung an der Universität überhaupt nicht – wie könne man nur die Zeit mit so etwas wie Methodenlehre vergeuden – das ginge an den Bedürfnissen der Praxis völlig vorbei. So etwas brauche man schlicht und ergreifend gar nicht – vielleicht sei das etwas für Professoren.
Das hat mich schon nachdenklich gemacht – auf der anderen Seite:
Angenommen, ein Jurist hätte in seinem ganzen Leben noch nie etwas von Methodenlehre gehört – konnte er dann seinen Beruf tatsächlich nicht ausüben? Ich glaube nicht. Will sagen: Was ganz genau ist eigentlich Methodenlehre? Wie wirkt sie auf die juristische Entscheidungsfindung ein? Braucht man sie überhaupt? Oder fliegt sie einem sozusagen zu?
Methodenlehre – Braucht man das?
Wenn mich nicht alles täuscht, so hat Charlotte wahrscheinlich Recht und zwar aus einem einfachen aber überraschenden Grund:
Wir konnten tatsächlich auf die Methodenlehre als Vorlesung verzichten, weil die Methoden der rechtlichen Entscheidungsfindung in jeder anderen Vorlesung sowieso –implizit – mitvermittelt werden.
Wir reden nur nicht darüber.
Will sagen: Jeder Student, der einige Wochen Bürgerliches Recht, Strafrecht oder Verfassungsrecht gehört hat, weiß bereits, wie Juristen denken, mit welchen Methoden sie sich einer Falllösung nähern – er weiß nur nicht, dass hinter diesem Entscheidungssystem etwas steckt, was man Methodenlehre nennt.
„Etwas kryptisch“–meint Charlotte – „kannst du das vielleicht auch mal erklären?“ „Ganz einfach“, sage ich, „du weißt es doch, was eine Falllösung ist, oder?“ „Klar“, sagt Charlotte, „das weiß doch jeder“. „Eben“, sage ich. „Also, der Unterricht beginnt und was passiert als allererstes?“ – „Wir lösen einen Fall? “ „Und danach? “ –„Wir lösen den nächsten Fall und den nächsten Fall und das machen wir von jetzt an lebenslang“.
D. h. das Leben der Juristen besteht nun einmal aus Falllösungen. Und was heißt es, einen Fall zu lösen? Auch wieder ganz einfach: Wir subsumieren einen Sachverhalt unter das geltende Recht und schließen daraus, ob jemand beispielsweise einen Anspruch hat oder zu bestrafen oder vielleicht auch nicht zu bestrafen ist. „Genau“, sagt Charlotte, „genau so ist es, das mache ich von morgens bis abends“ –„Und genau das“, so sage ich zu ihr, „mache auch ich noch immer von morgens bis abends – von kleinen Unterbrechungen mal abgesehen – aber das ist nun mal das Geschäft des Juristen.
„Ja, und“, sagt Charlotte, „was ist nun mit der Methodik? “ „Die Methodik“, sage ich, „ist einfach Teil des Falllösungsprozesses“. Nochmal: Falle lösen heißt, einen Sachverhalt subsumieren und dann den Schluss ziehen, ob der eine oder der andere oder vielleicht ein Dritter Recht hat. Wenn man sich im nächsten Schritt fragt, was eigentlich subsumieren bedeutet, dann hat man bereits die Methodik des Rechtswissenschaftlers – aber eben auch des Rechtsanwenders – in der Hand.
Will sagen: Die Familienrichterin, von der ich zu Beginn erzählt habe, wendet tagtäglich die Methodenlehre an – sie weiß es nur nicht. Trotzdem macht sie dabei alles richtig. Warum? Weil sie es mit der Muttermilch aufgesogen hat, dass man einen Sachverhalt unter den rechtlichen Tatbestand subsumiert und daraus Schlüsse ableitet und zwar solche, die logisch sind – so etwas nennt man seit Aristoteles Syllogismus -? „Aha“, sagt Charlotte. „Naja so ist das eben“, erwidere ich.
Subsumtion als Methodik
Und jetzt nochmal zurück: Was meinen wir mit Subsumtion – denn das ist der Schlüssel für die Methodenlehre. „Naja“, sagt Charlotte, „eigentlich ganz einfach: Man guckt ins Gesetz und da steht ja, worauf man Anspruch hat oder was man besser nicht tut, wenn man nicht bestraft werden will oder wann man die Grenzen der Verfassung überschreitet.“ „Naja“, sage ich, „ganz so einfach ist es wohl doch nicht – viele Leute gucken ins Gesetzbuch und wissen danach überhaupt nichts, oder?“
„Auch wieder wahr“, sagt Charlotte. – „Und“, sage ich, das ist übrigens der Hauptgrund dafür, warum die Menschen noch nicht mal ein Bürgerliches Gesetzbuch zu Hause haben, obwohl das die Regeln enthält, die ihr gesamtes Leben von morgens bis abends bestimmen. Grund: Auch wenn sie reingucken, sie werden kaum schlauer.“ „Überraschend für mich“, sage ich, „ist dabei, dass sie trotzdem den Rechtsstaat akzeptieren, obwohl sie im Regelfall erst erfahren, wie das Recht eigentlich genau aussieht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Das ist für mich ein überraschender sozialogischer Vorgang, der da in uns Menschen stattfindet. Wir vertrauen also unseren Juristen und in gewissen Grenzen auch unserem Gesetzgeber, dass er es für uns einigermaßen fair richten wird und lassen uns erst im Streitfall sagen, wie es denn eigentlich ganz genau aussieht.“
„Du läufst gerade vom Thema weg“, sagt Charlotte, „es geht doch um Methodik und nicht darum, warum der Rechtsstaat funktioniert, obwohl keiner ein Gesetzbuch zu Hause hat und auch nie reinguckt“. „Stimmt“, sage ich. „Also: Juristen lernen vom ersten Tage an, dass man einen Fall nach einem ganz bestimmten Muster löst. Dieses Muster nennen Juristen Subsumtion, als unterordnen eines Sachverhaltes unter den Tatbestand einer oder mehrerer Normen.“
Was genau passiert da? Ein ziemlich komplizierter und komplexer Vorgang. Der Jurist schaut sich zunächst einmal an, welches Problem Menschen haben, z. B. die Waschmaschine, die man sich gerade gekauft hat, schleudert nicht. Irgendwie ist jedem klar, dass eine Waschmaschine schleudern können muss – da stimmt also etwas nicht. Im Gehirn des Juristen leuchtet für diesen Fall eine Normengruppe auf – nämlich das Kaufrecht im BGB.
Der Jurist kommt gar nicht auf den Gedanken, dass eine anderen Normengruppe in Betracht kommen konnte, weil klar ist, dass es nur Kaufrecht sein kann – der Erwerb der Waschmaschine beruht auf einem Kaufvertrag und irgendetwas am Kaufgegenstand scheint fehlerhaft zu sein. Allein auf diese Idee zu kommen, dass es sich in diesem Zusammenhang um einen Kaufvertrag handeln muss, ist einem Nichtjuristen nicht mehr vermittelbar.
Das liegt daran, dass Nichtjuristen gar nicht wissen, welche Vertragstypen das BGB enthalt – sie differenzieren also nicht zwischen einem Kaufvertrag, dem Tauschvertrag, dem Leasingvertrag und dem Mietvertrag – sondern sie nehmen einfach hin, dass ihnen nicht klar ist, an welcher Stelle man ins Gesetz gucken müsste, um über den Fehler der Waschmaschine nachdenken zu können. Dafür gehen sie halt zu einem Juristen.
Will sagen: Der Subsumtionsprozess ist auch bei Juristen überhaupt erst dann möglich, wenn eine gewissen Grundmenge an Normen im Kopf gespeichert ist, so, dass man die Frage beantworten kann, in welche Kategorie gehört eigentlich ein Sachverhalt, den man gerade hört. Wenn ein Jurist hört, dass sich der Nachbar vom Untermieter ein Ei geliehen hat, dann weis er sofort, dass das keine Leihe sein kann, weil man das Ei nach Verbrauch eben nicht zurückgeben kann. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem geliehenen Ei um ein Darlehen – das allerdings dürfte für den Menschen auf der Straße verblüffend sein.
Tatbestandsmerkmale zusammenstellen
Wie auch immer, subsumieren geht erst dann, wenn man eine ganze Menge an Rechtsnormen im Hinterkopf hat, wenn man weiß, wie das BGB strukturiert ist, welche Straftatbestande es im StGB gibt und welche Freiheits- und Grundrechte eigentlich die Verfassung zur Verfügung stellt. Das alles muss man wissen, weil man sonst gar nicht weiß, welche Normen man aufrufen muss, um einen Sachverhalt – also eine problematische Frage (Waschmaschine schleudert nicht) subsumieren zu können
Das ist übrigens auch der Grund, warum Erstis so oft Schwierigkeiten mit dem Subsumieren haben – in ihrem Kopf ist eben das BGB oder das StGB noch nicht abgebildet, d. h. sie selber wissen noch gar nicht, welche Kategorien sie jeweils aufrufen sollten und sind bei der Geschichte mit dem geliehenen Ei vielleicht genauso verblüfft, wie der Mensch draußen auf der Straße.
Wenn aber der Kaufvertrag im Kopf aufleuchtet, nachdem man gehört hat, dass die Waschmaschine nicht schleudert, dann kann man jetzt im nächsten Schritt fragen, welche Regeln enthalt denn eigentlich das Kaufrecht für den Fall, dass die Kaufsache mangelhaft ist. Schnell ist man bei § 437 BGB gelandet und lernt, dass man bei einem Fehler verschiedene Ansprüche hat und u. a. auf Nachbesserung, evtl. auch Rückgabe und vielleicht auch Schadensersatz.
Jetzt passiert das, was man Entwickeln des Tatbestandes nennt – es entsteht der Satz: Wer will was von wem woraus? Man sucht also bei den verschiedenen Regeln, die das Gesetz enthalt diejenigen zusammen, die für den jeweiligen Fall zusammengehören und entwickelt aus diesen die Tatbestandsmerkmale, die allesamt vorliegen müssen, damit am Schluss jemand einen Anspruch darauf hat, dass die nicht schleudernde Waschmaschine in eine verwandelt wird, die doch schleudert – denn dafür hat er ja bezahlt.
Dieses Zusammenstellen von Tatbestandsmerkmalen, die in der jeweiligen Fallsituation zusammengehören, ist die eigentliche schwierige Aufgabe von Juristen. Wenn man dabei alles richtig gemacht hat, dann kann fast nichts mehr schief gehen.
Die meisten Falllösungen, die falsch sind, kranken daran, dass irgendjemand ein Tatbestandsmerkmal vergessen hat oder eins hinzugefügt hat, das da gar nicht hingehört oder mit einem völlig falschen Paragrafen arbeitet. Wenn man aber alles richtig gemacht hat, dann weis man jetzt, welche Tatbestandsmerkmale vorliegen müssen, um sagen zu können, A hat den Anspruch gegen B auf Nachbesserung der Waschmaschine, sodass diese am Schluss schleudert.
Um zu dieser Aussage zu kommen, muss man den Sachverhalt – Kauf einer Waschmaschine, die nicht schleudert – unter die Normengruppe, die man gerade zusammengesucht hat, subsumieren, also unterordnen, und sich fragen, ob jedes Tatbestandsmerkmal vorliegt oder nicht.
Die erste Frage wird beispielsweise lauten, ob überhaupt ein Kaufvertrag geschlossen wurde (§ 433 Abs. 1 BGB). Das konnte beispielsweise daran scheitern, weil eine der beiden Seiten minderjährig und folglich möglicherweise gar nicht in der Lage war, einen wirksamen Kaufvertrag abzuschließen (schon muss man die Normengruppe um § 104 BGB herum in seine Überlegungen miteinbeziehen).
Sollte sich also herausstellen, dass der Kaufvertrag in Wirklichkeit gar nicht zustande gekommen ist, ist an dieser Stelle bereits Schluss – d. h. einen Anspruch auf Nachbesserung hat man natürlich nicht – man hat ja die Waschmaschine gar nicht gekauft. Nun konnte man natürlich über die Frage nachdenken, wovon es eigentlich abhängt, ob ein Minderjähriger einen wirksamen Kaufvertrag schließen kann.
Kann er das zum Beispiel mit seinem Taschengeld allein tun? Oder kommt es vielleicht darauf an, ob der Kauf für ihn ausschließlich ein rechtlicher Vorteil oder zumindest kein wirtschaftlicher Nachteil ist? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem rechtlichem und einem wirtschaftlichen Vor- oder Nachteil? Überlegungen dieser Art muss man anstellen, weil der Minderjährige zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters bedarf (§ 107 BGB).
Nun konnte man sagen, dass der Minderjährige (z. B. 17 Jahre alt) einfach eine Waschmaschine braucht, weil er nämlich sein Studium begonnen hat und irgendwie seine Wäsche waschen muss. Man konnte jetzt überlegen, ob die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (damit sind wir im Familienrecht) vielleicht konkludent vorliegt, eben weil der gesetzliche Vertreter damit einverstanden war, dass der Minderjährige an einem fremden Ort das Studium der Rechtswissenschaft aufnimmt.
Vielleicht liegt darin ja auch zugleich die Einwilligung in den Kauf einer Waschmaschine? Um das herauszufinden, muss man untersuchen, ob ein gesetzlicher Vertreter (Eltern), der das Studium an einem fremden Wohnort in einer fremden Wohnung (gemietet?) erlaubt, damit automatisch auch in den Kauf einer Waschmaschine einwilligt. Ist das so? Worauf kommt es bei dieser Willensbildung an? Vielleicht auf typische vergleichbare Eltern? Oder auf eine Üblichkeit, jedenfalls im Kreise von Studierenden? Kann man hier vielleicht die eine oder andere Analogie zu den Eltern anderer Minderjähriger ziehen?
Das sind naheliegende Fragen, die sich alle aus der Natur der Sache, nämlich daraus ergeben, dass die Eltern ja bereit sind, dass der Minderjährige sein Studium in einer fremden Stadt in einer fremden Wohnung aufnimmt und damit aller Wahrscheinlichkeit nach auch bereit sind, dass er sich eine Waschmaschine kauft, denn irgendwie muss er ja die Wäsche waschen.
Etwas anderes konnte vielleicht gelten, wenn man erführe, dass die Eltern mit dem Minderjährigen verabredet haben, sich alle 2-3 Wochen einmal zu treffen, um die schmutzige Wäsche zu waschen. Das wäre ein starkes Indiz dafür, dass es an der Einwilligung zum Kaufvertrag wohl doch fehlt.
Methodenlehre in Form von Argumentation
Alle Überlegungen, die wir gerade eben mit Blick auf die Einwilligung durchgeführt haben, kann man in methodische Argumentationsfiguren ummünzen. Man kann z. B. sagen, dass man gerade eine Analogie bildet oder umgekehrt, dass man gerade das Gegenteil von etwas annimmt, wenn man erfährt, dass man sich alle 3 Wochen treffen will, um die Wasche zu waschen. Man kann auch fragen, welchen Sinn und Zweck eigentlich das Einwilligungserfordernis in § 107 BGB hat – offenbar soll es den Minderjährigen schützen – wovor eigentlich?
Möglicherweise vor Belastungen aus Waschmaschinenkaufvertragen. Dem konnte man vielleicht entgegenhalten, dass der Minderjährige gar keinen Schutz braucht, weil er gerade von der Oma 3.000,00 EURO geerbt hat. Daraus wiederum wurde sich die Frage ergeben, ob es zwischen dem rechtlichen und wirtschaftlichen Nachteil vielleicht einen Unterschied gibt. Rechtlich ist der Minderjährige mit dem Kaufvertrag belastet, wirtschaftlich kann er sich die Waschmaschine aber leisten, er hat genug Kleingeld. Braucht er nun Schutz vor dem Recht oder Schutz vor wirtschaftlicher Belastung?
Welchen Sinn und Zweck hat die Norm – d. h. müssen wir das Einwilligungserfordernis bei dem Minderjährigen, der genug Geld auf dem Konto hat, vielleicht teleologisch begrenzen? Grund: Es gäbe überhaupt keinen Sinn, ihm den Kauf der Waschmaschine zu verweigern, er hat ja genug Kleingeld.
Wie auch immer – alles das, was wir gerade gemacht haben nennt man Methodenlehre. Wir haben gerade die von dem berühmtesten deutschen Juristen, nämlich Savigny, entwickelten Argumentationskanone hergeleitet, nämlich die grammatikalische Auslegung, die sich am Wortlaut des Gesetzes festhält, die historische Auslegung, die danach fragt, was der Gesetzgeber ursprünglich wollte, die systematische Auslegung, die klart, wie das Tatbestandsmerkmal im jeweiligen systematischen Zusammenhang auszulegen ist, und die teleologische Auslegung, die sich am Sinn und Zweck der Norm orientiert.
Dafür haben wir verschiedene Argumentationsfiguren benutzt, die wir alle aber auch aus dem allgemeinen sprachlichen Diskurs kennen. Es geht um den Analogieschluss, den Umkehrschluss (argumentum e contrario), den Erst-Recht-Schluss (argumentum a fortiori), das argumentum ad absurdum und das teleologische Argument.
Robert Alexy, der im Jahre 1983 eine vielbeachtete Theorie der juristischen Argumentation veröffentlicht hat, meint, dass Juristen genau gesehen mit allen Argumentationsfiguren des allgemeinen sprachlichen Diskurses arbeiten, dass es also überhaupt keine Argumentationsfiguren gibt, die bei der juristischen Entscheidungsfindung verboten wäre, sodass die fünf Argumentationsformen, die gerade eben genannt wurden, letztlich nur Beispiele für die Möglichkeit sprachlicher Argumentation stehen.
Wenn wir z. B. in einer hitzigen Debatte sagen, dass wir das schon seit über 20 Jahren so machen, dann wurde ein Jurist an der Stelle sagen, die herrschende Meinung stehe seit 20 Jahren auf dem Standpunkt, dass man einen Fall so oder so lösen sollte. Sie merken, damit sind die Argumentationsfiguren herrschende Meinung einerseits und Mindermeinung andererseits geboren.
Oftmals wird auch gesagt, dass man das Recht missbraucht und aus dem Missbrauch wohl möglich Vorteile zieht – das dürfe nicht sein – das ist ein juristisches Argument, das sich aus dem Schikaneverbot (§ 226 BGB) ergibt. Gelegentlich wird auch vorgebracht, dass jemand das Recht umgeht, also etwas Verbotenes anstrebt und dabei nur so tut, als sei es erlaubt. Damit ist das Umgehungsverbot angesprochen, welches als Rechtsprinzip bei jeder juristischen Argumentation erlaubt ist, gelegentlich aber auch im Gesetzbuch ausdrücklich erwähnt wird.
So heißt es etwa in § 506 BGB, dass die Vorschriften über den Verbraucherkredit auch dann Anwendung finden, wenn sie durch anderweitige Gestaltung umgegangen werden. Kürzlich wurde darüber nachgedacht, ob dieser Fall der Umgehung bei Versicherungsvertragen vorliegt, wenn der Kunde für die monatliche oder vierteljährliche Zahlungsweise Zinsen zahlen muss.
Sie sehen: Die juristische Argumentationsmethodik begleitet Sie vom ersten Tage Ihres Studiums an auf Schritt und Tritt. Sie wenden diese Theorie an, wenn Sie einen Fall lösen – anders konnten Sie ihn gar nicht lösen. Sie schauen auf den Wortlaut der Norm, auf ihren historische und systematischen Zusammenhang und ganz besonders wichtig: Sie orientieren sich an ihrem Sinn und Zweck.
Am Ende sind Sie in der Lage zu sagen, ob der Kaufvertrag über die Waschmaschine geschlossen war und der Käufer nach § 437 BGB Nacherfüllung verlangen oder sogar vielleicht vom Vertrag zurücktreten kann.
Anders formuliert: Wenn Sie BGB lernen oder Straf- oder Verfassungsrecht, dann lernen Sie automatisch die Theorie der juristischen Argumentation – anders konnten Sie nämlich keinen einzigen Fall lösen. Sie wissen nur nicht, dass Sie auf der Grundlage der Theorie der juristischen Argumentation argumentieren – es ist Ihnen nicht bewusst, dass Sie die Tatbestandsmerkmale der Normen anhand er Canonis von Savigny auslegen und Ihnen ist auch nicht klar, dass Sie sich sehr oft der fünf Argumentationsformen des juristischen Diskurses bedienen.
Sie unterscheiden nicht zwischen interner und externer Begründung der juristischen Entscheidung – aber: Sie lösen den Fall ohne wenn und aber, präsentieren eine blitzsaubere Argumentation pro und contra und bekommen dafür 15 Punkte.
Die methodische Grundlage der Argumentation
Warum sollten Sie sich jetzt eigentlich noch mit der juristischen Methodenlehre beschäftigen? Sie können doch schon alles – oder? Ja – und ein bisschen auch nein. Das Ja steht für Ihre Fähigkeit, den Fall zu begreifen und mithilfe des Gesetzbuches zu lösen. Das ist das Juristenhandwerkzeug. Nein stimmt aber auch, weil Sie genau gesehen nicht wissen, was Sie tun.
Sie wenden das Gesetz an, Sie argumentieren pro und contra, Sie zitieren Gerichtsurteile und Meinungen von Rechtsgelehrten aber: Wenn man Sie fragt, warum Sie das eigentlich tun, ob Ihnen eigentlich klar ist, was Sie da machen und ob es möglicherweise auch so sein kann, dass das eine und andere Argument ganz unzulässig ist, darin müssen Sie passen.
Will sagen: Ihnen fehlt die methodische Grundlage Ihrer Argumentation bei der Falllösung, Sie wissen nicht, ob das, was Sie gerade argumentieren zulässig oder unzulässig ist. Sie wissen übrigens auch nicht, ob eine der Argumentationsformen, die Sie gerade verwendet haben, möglicherweise die andere verdrängt, also ob es so etwas wie einen Vorrang oder einen Nachrang der Argumentationsfiguren gibt.
Vielleicht schauen Sie noch einmal in § 107 BGB hinein. Dort ist von einem rechtlichen Nachteil für den Minderjährigen die Rede. Das ist vom Wortlaut her sehr eindeutig – aus Sicht der grammatikalischen Interpretation wurde man sagen, dass völlig klar gemeint rechtliche Vorteile oder Nachteile sind. Schaut man aber einmal auf den Sinn und Zweck der Norm, so stellt man schnell fest, dass es um den Schutz des Minderjährigen vor übermäßigen wirtschaftlichen Belastungen geht.
Wenn ich einem Minderjährigen 50,00 Euro schenke, dann ist diese Schenkung nur wirksam, wenn der Minderjährige das Schenkungsversprechen annimmt. Das ist für den Minderjährigen ein rechtlicher Nachteil. Die 50,00 Euro sind für ihn aber ein wirtschaftlicher Vorteil. Nach dem Sinn und Zweck des § 107 BGB soll man dem Minderjährigen die 50,00 Euro schenken können, obwohl das gegen den Wortlaut der Norm verstößt. Hat man nun der Wortlaut oder der Sinn und Zweck der Norm Vorrang?
Eine Antwort auf diese Fragefinden Sie beim besten Willen nicht im Gesetzbuch. Jetzt müssen Sie doch einmal ein Lehrbuch zur Theorie der juristischen Argumentation aufschlagen, um herauszufinden, ob es so etwas wie einen Vorrang oder einen Nachrang der Argumentationsfiguren zueinander gibt. In der Regel wird heute gesagt, dass der Sinn und Zweck der Norm alles andere verdrängt – es gibt allerdings auch Stimmen, die meinen, dass sich Gerichte nicht über den klaren Wortlaut des Gesetzes hinwegsetzen dürfen, weil sie dann ja contra legem entscheiden würden.
Sie sind in einer solchen Situation möglicherweise gezwungen, gegen den Sinn und Zweck – d. h. nach dem Wortlaut – zu entscheiden und den Gesetzgeber darauf aufmerksam zu machen, dass eine Korrektur im Gesetzbuch erfolgen musste. Viele Juristen sagen heute aber, dass die Gerichte sehr wohl berechtigt sind, dem Sinn und Zweck einer Norm bei der Auslegung den Vorrang zu geben, auch wenn der Wortlaut entgegensteht.
Das wird aus Art. 20 Abs. 3 GG abgeleitet, wonach die Richter an Gesetz und Recht gebunden sind. Die Bindung an das Recht beinhaltet auch die Bindung an die allgemeinen übergesetzlichen Rechtsprinzipien, wie etwa das Gebot der funktionalen Interpretation einer Norm nach ihrem Sinn und Zweck.
Wenn man es so sieht, dann setzt sich der Sinn und Zweck einer Norm auch gegen den Wortlaut durch – Sie merken schon, Überlegungen dieser Art können Sie nur anstellen, wenn Sie sich mit der Theorie der juristischen Argumentation beschäftigt haben.
Fazit: Erst die Grundlagen, dann die Methodenlehre
Was folgt aus alledem? – Selbstverständlich müssen sich Juristen mit der Theorie der juristischen Argumentation auseinandersetzen. Sie müssen wissen, warum sie so argumentieren wie sie argumentieren und ob es Grenzen für eine zulässige oder unzulässige Argumentation gibt.
Wer die Methoden des eigenen Faches nicht begriffen hat, gelangt nur zufällig zu vernünftigen und gerechten Entscheidungen. Es wäre ungefähr so, als wurde man eine Sprache lernen, sich aber nie mit der ihr zugrundeliegenden Grammatik und Syntax beschäftigen.
„Und?“, fragt Charlotte, „was heißt das konkret?“ – Jetzt schau ich zu ihr zurück und sage: „Was meinst du, was sollten wir unseren Erstis raten?“ „Also wenn ich mir das alles so anhöre“, sagt Charlotte, „dann werde ich an der Theorie der juristischen Argumentation wohl nicht vorbeikommen.“ „Das sehe ich auch so“, antworte ich. „Aber“, setzt sie fort, „was soll ich damit im ersten Semester?“ – „Genau“, erwidere ich ihr, „das frage ich mich ehrlich gesagt auch: Was sollen die Erstis um Himmels Willen mit der Theorie der juristischen Argumentation im ersten Semester?
Das wäre so, als wenn ich in der 1. Klasse nicht nur lesen und schreiben, sondern auch gleich noch Grammatik lernen musste. Das würde garantiert schief gehen – es gibt einen guten Grund, dass man die methodische Struktur einer Sprache, also Grammatik und Syntax, erst dann lernt, wenn man die Sprache längst perfekt kann. Dann begreift man auch sofort den Sinn der Übung. Man kann nämlich mit der Sprache, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Sprachen, sehr viel spielerischer, sehr viel präziser, sehr viel zielsicherer umgehen, wenn man auch die Grammatik und die Syntax beherrscht.
Genau so ist es auch in der Juristerei“ –„Und?“ – Charlotte schaut mich fragend an – „Naja“, sage ich, „ daraus folgt, dass ich jedenfalls juristische Methodenlehre niemals im ersten Semester, sondern frühestens im 5. oder 6. Semester anbieten würde.“ „Naja“, sagt Charlotte“, „aber was heißt das denn nun für die Erstis?“ – „Das heißt“, sage ich zögernd, „dass ich keine gute Antwort habe.
Ich weiß, dass die Erstis im ersten Semester juristische Methodenlehre oder auch Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie oder Rechtsgeschichte lernen müssen – lauter Dinge, die sie nach meiner Überzeugung frühestens im 5., 6. Semester und manchmal sogar erst später sinnvoll begreifen können. Trotzdem sind die Ausbildungsplane so wie sie nun einmal sind – ich selbst habe in meinem Studium genau dasselbe erlebt. Auch bei mir war es so, dass ich im ersten Semester die Grundlagenfächer einfach machen musste.
Ich habe mich dann später entschlossen, einfach nochmal in dieselben Grundlagenvorlesungen zu gehen. Im 7. Semester saß ich erneut bei Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte und Rechtsmethodik – sehr zum Verblüffen der Professoren, die ich jetzt nämlich mit Fragen löcherte, die man von einem Ersti nicht erwartet.
Die Erstis waren übrigens auch ziemlich verblüfft, weil sie gar nicht wussten, dass man so ziemlich abgedrehte Fragen stellen kann – will sagen: Ein Lehrplan ist nur ein Lehrplan – jeder Student hat das Recht in jede Vorlesung zu gehen, die ihm oder ihr gefällt. Also sollte man sich die Freiheit nehmen, hier und da auch ein paar kleine Korrekturen in den Plan einzufügen – wenn man das tut, dann kann man von der juristischen Methodenlehre eine Menge lernen.“