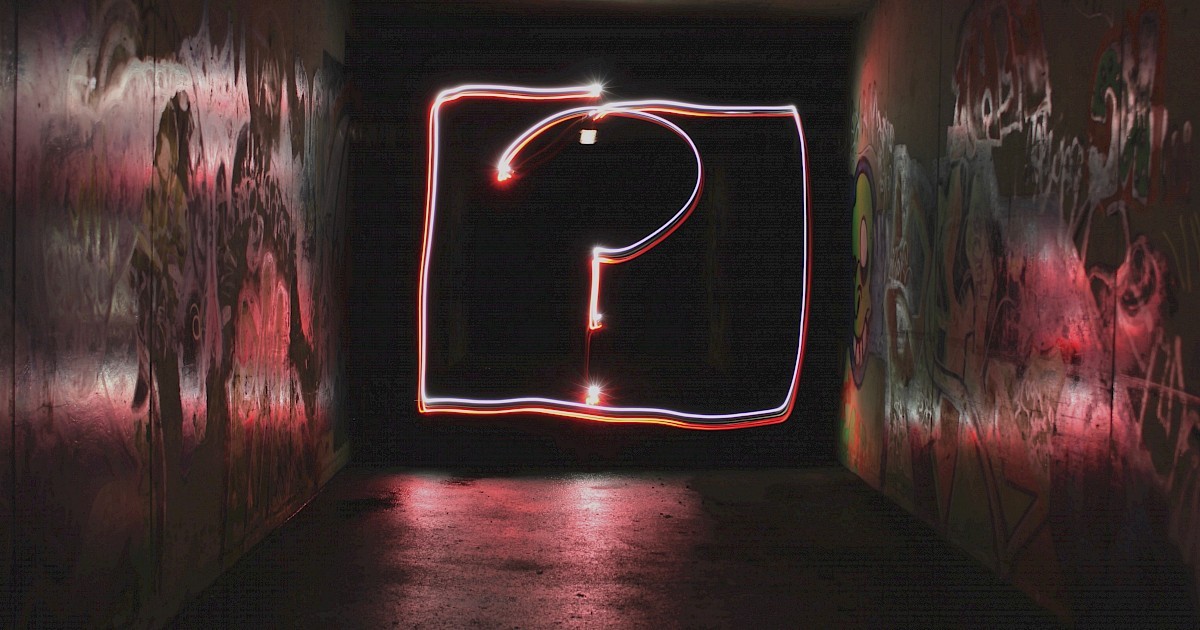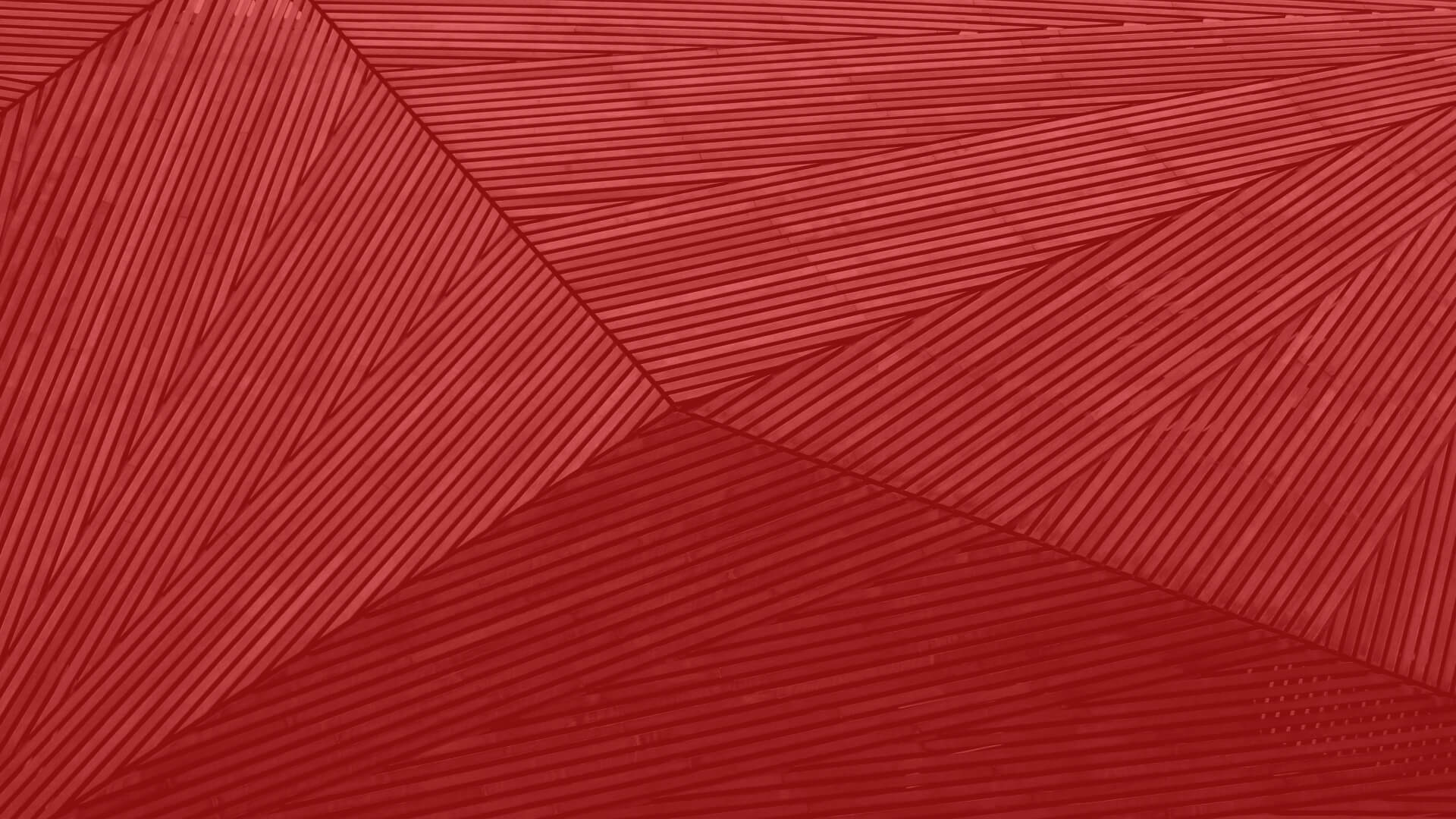Die juristische Benotung ist ein ewiger Zankapfel. Einer Absolventin kostete der Streit über ihre Bewertung bereits die Anwaltszulassung (http://rsw.beck.de/cms/main?docid=377316). Regelmäßig beginnen Beiträge über die juristische Notenskala mit einer entsprechenden Leidensanekdote, dass man der Oma, Tante, dem Erbonkel oder der Verlobten erklären muss, warum man sich über die erhaltenen 9 von 18 möglichen Punkten freut wie ein Honigkuchenpferd. Es folgen Erklärungen, die jeder Jurist zur Erschöpfung hinter sich hat.
Auf LTO wurde am 28.11.2016 ein Beitrag von Julia Marinitsch veröffentlicht, ihres Zeichen Doktorandin und Verfechterin der good ol´ Juranote, die sie nach eigenen Angaben immerhin schon eintausendmal selbst vergeben habe.
Das Plädoyer: Die juristische Ausbildung ist gut, die Benotung gerecht und sie erlaubt ein differenziertes und ausgewogenes Bild auf die Absolventen, welche anhand ihrer Note in dem späteren „Job“ vom „Humanressourcer“ anständig eingeordnet werden können. Wichtigste Erkenntnis: 6 Punkte sind keine schlechte Leistung!
Totschlagargumente liefert sie bezüglich anderer Studiengänge gleich mit. Ein Studienabgänger, der mit einem Abschluss von unter „1,3“ keine Arbeit findet, wäre mit einem juristischen Examen viel besser bedient gewesen. Der Humanressourcer kann ja immerhin zwischen einer breiten Notenskala wählen. Hier kann dann eine Promotion oder ein Partyjahr im Ausland – bevorzugt mit Barexam der Anwaltskammer New York und einer zehntausend Dollar schweren Masterarbeit noch zur Qualifikation und damit zur Qualität des Bewerbers beitragen. Das wird auch direkt in bar belohnt.
Den „Qualitätsanspruch“ den sich die Kanzlei „Hogan Lovells“ erwartet, dotiert sie auch direkt mit 5.000 Euro jährlich pro Namensverlängerung. Klar. Die Mandanten bezahlen ja dafür. Wieso sollte man das Geld auch einem gewöhnlichen (Fach-)Anwalt geben, wenn man einen Masterdoktor haben kann?
Arbeitsmarkt entscheidet anhand der Note
Nun aber zurück zum Thema: „Die juristische Notenskala erlaubt eine Differenzierung, die vielen anderen Fächern vorenthalten ist. Das ist ein Vorteil. Es gibt Studiengänge, in denen mit einem Abschluss mit einem Schnitt von unter 1,3 kein Job mehr zu finden ist.“ heißt es in dem Artikel.
Der Markt, der solchen (welchen genau bleibt die Autorin schuldig) Studiengängen zugrunde liegt, ist wohl hoch umkämpft. Hierfür gibt es leider viele Gründe. Einer ist, dass Studienabgänger der Psychologie, Medizin etc. maßgeblich staatlich bezahlt werden. Die wenigen Plätze werden verteilt. Unter den vermeintlich besten. Also jenen, die viel Zeit mit lernen verbracht haben.
In der Juristerei besteht jedoch ein ähnlicher Wettbewerb. Die Staatsnote berechtigt zum Einlass in den sicheren Staatsdienst mit Pension, Familienzuschlag, Urlaub und häufig eigenem Personal. Die Staatsnote ist auch Verhandlungsmacht. Bringe ich diese Note mit, kann ich mindestens das Verlangen, was der Staat bereitstellt.
Darunter wird es eher düster. Anwälte, die mit 30.000 Euro im Jahr als Scheinselbständige oder mit 15 Euro die Stunde abgespeist werden, sind nicht eine seltene Ausnahme sondern die immer häufigere Regel (die Zahlen basieren auf Erfahrungswerten aus dem echten Leben).
6 Punkte sind keine schlechte Leistung! – Weiß das auch der Arbeitgeber?
Ob ich im Examen aufgrund von Lückenunwissen, einem launischen Korrektor oder lediglich aufgrund eines Blackouts an der Staatsnote vorbeigeschrammt bin, fragt mich der Humanressourcer nicht. Er lädt schlicht denjenigen ein, der die Note bringt. Wichtigste Erkenntnis für den abgelehnten Bewerber: 6 Punkte sind keine schlechte Leistung! Wo genau findet sich der Vorteil der Diversität der Notenskala?
Die Argumentation geht weiter: „Fachrichtungen, in denen ein gewaltiger Prozentsatz der Teilnehmer pauschal in den ersten Semestern mit 5,0 für immer ausscheidet.“ Hier lässt sich erwähnen, dass – wie die Autorin selbst aufzeigt, von ca. 96.000 Studienanfängern endlich nur 11.000 vor einem Prüfgremium landen. Im Jurastudium wird man nicht zum Hauptstudium zugelassen, wenn die Zwischenprüfung nicht bestanden wird. Im Zweifel fällt Bafög weg (weil das an die Note gekoppelt wird) und beendet so das Studium der wenigstens weniger betuchten.
„Im ersten Beispiel weiß der potentielle Arbeitgeber regelmäßig nur anhand der Noten nicht, wie gut der Bewerber tatsächlich ist, und muss stattdessen andere Kriterien suchen.“ Die Frage ist, woher weiß der Arbeitgeber dies bei einem Juristen? Eine Subsumtionsmaschine mit 12 Punkten gibt noch lange keinen guten Anwalt.
Ein Jurist mit 4 Punkten hingegen kann ein Spitzenanwalt sein. Dies zeigt sich aber erst in der Praxis. Oder durch viele Nebentätigkeiten, während des Studiums und Referendariats. Wobei natürlich unter der Nebentätigkeit wieder die Examensnote leidet.
Klar, die Großkanzlei, die für zwei Jahre Vertragsersteller für das Hinterzimmer ohne Mandantenkontakt sucht, profitiert von 12 Punkten, die jemand in Stresssituationen abliefert. Aber was genau sagt die Note über soziale Kompetenzen im Mandantengespräch, wirtschaftliche Denkweise, effizientes Organisationsmanagement oder Führungsfähigkeiten aus?
Ob im Examen häufig die im Repetitorium („Volltreffer!“) durchexerzierten Standardfälle oder aber komplizierte Exoten abgefragt werden, ist Glücksache. Glück bei der Prüfung insgesamt, beim Korrektor oder eines der sonstigen vielen Kriterien, entscheidet über die Note und damit das Schicksal des Juristen. Ob er die magische Staatsnote erwischt oder leider leider nur mit 7 oder 6 Punkten einer von vielen wird, die sich massiv um ihre Zukunft sorgen müssen, hängt von einem Benotungssystem ab, das undurchsichtig und für den Prüfling in vielen Fällen nicht nachvollziehbar ist.
Die von der Autorin angesprochenen Punkte treffen in der Theorie zwar zu, dies tun sie aber eben auch in anderen Studiengängen. Die Vorteile der 18 Punkteskala, die in der Realität ihr Ende bei 14 (und auch das nur sehr selten) sieht, erschließen sich leider nach der Lektüre des Artikels nicht. Noten sind letztlich nur die Erkenntnis, die sich aus wenigen Prüfungssituationen (und damit besonderen Situationen, welchen sich der Berufsträger später nicht mehr stellen muss) ergeben.
Sie sind daher zur Beurteilung der persönlichen Fähigkeiten im praktischen Arbeitsumfeld später genauso unbrauchbar wie in sämtlichen anderen Berufen, in welchen man sich ausschließlich anhand irgendwelcher Noten ein Bild von dem zukünftigen Arbeitnehmer machen will. Die Autorin scheint das nicht zu verstehen und ist deswegen von diesem System so begeistert. Sie wird sich aber als Universitätsangestellte wohl darüber auch nie Gedanken machen müssen. Sie hat ja schließlich die Staatsnote.
Der Autor dieses Beitrages, Dipl. Jurist Michael Scheyhing, ist Betreiber des juristischen Blogs „Gameslaw“ (https://gameslaw.online/)