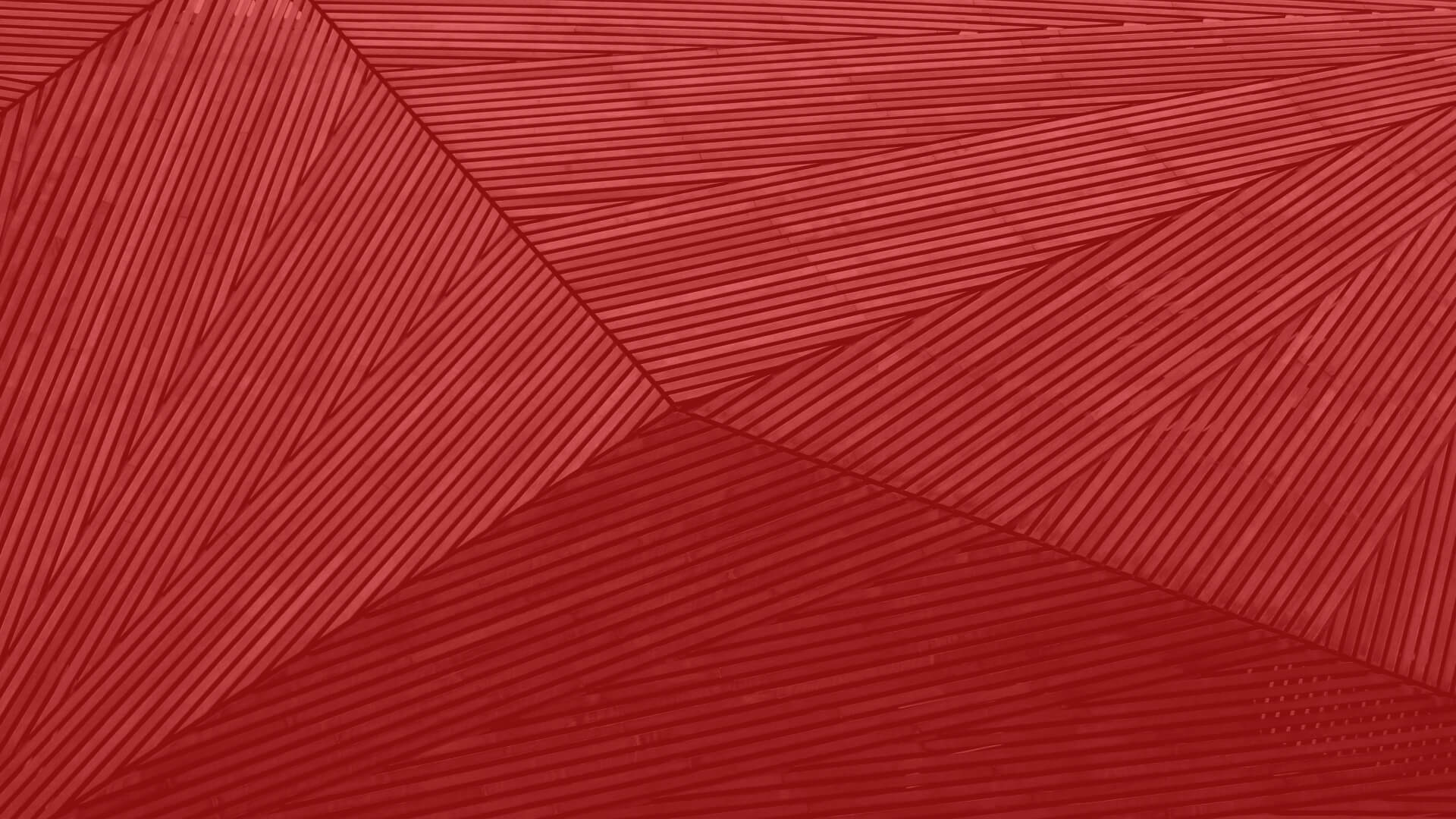Erst kürzlich haben wir über einen Staatsanwalt berichtet, der nun selbst vor Gericht steht. Während der beschriebene Fall bei Nichtbeteiligten wegen einiger lustiger Zufälle noch schmunzeln lässt, ist ein anderer Fall sehr viel heikler und sorgt in unserer Redaktion für bestürztes Kopfschütteln.
Es stellt sich die Frage: „Wie neutral muss ein Richter sein und kann es ihm angelastet werden, wenn er sich für Gerechtigkeit einsetzt?“ Zur Debatte steht folgender Fall: Es geht um den Richter Jan Robert von Renesse, gegen den ein Disziplinarverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf angestrengt wurde. Der Vorwurf: Rufschädigung der Sozialgerichtsbarkeit.
Das dem Vorwurf zugrunde liegende Geschehen beginnt vor etwa zehn Jahren mit der Verabschiedung des Gesetzes zur „Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto“.
Es ging um eine Besserstellung von Holocaust-Überlebenden. Wer während des zweiten Weltkriegs in Ghettos tätig war, konnte nun einen Antrag auf Arbeitsrente stellen.
Infolge dieser Gesetzeseinführung gingen etwa 88.000 Anträge bei der Rentenkasse ein, nur 7 % dieser genügten allerdings den Anforderungen. Dies führte dazu, dass viele der 93 % der Abgelehnten klagten. Hier kommt Richter Renesse ins Spiel, der -damals im Alter von 39 Jahren- über einige der Fälle entscheiden sollte.
Die erste Akte, die er hier bearbeitete, beinhaltete viele handgeschriebene russische Briefe einer Witwe, die zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann im Ghetto gehungert hatte und nun um Hilfe bat.
Die Behörden sandten ihr aber lediglich umfangreiche Fragebogen auf Deutsch zu, die sie nicht ausfüllen konnte. Nicht nur war sie der Sprache nicht mächtig, auch lagen die Ereignisse knapp 60 Jahre zurück und sich nach einer so langen Zeit an Arbeitsstelle, Arbeitszeiten und die Namen der Vorgesetzten zu erinnern, erscheint utopisch.
Richter Renesse fühlte sich berührt, schließlich ist seine Frau Polin, ihr Vater starb in einem KZ. Das Vorgehen kritisierte Renesse, man könne natürlich nicht alles unbesehen glauben, aber es sei auch falsch, sich auf irgendein Formular zu verlassen.
Die Formulare werden auch von Kurt Einhorn kritisiert, der eine emotionale Extremsituation beschreibt. Viele Richter gaben zunächst den Rentenversicherungen recht, da es nur schwer nachzuweisen war, dass man freiwillig im Ghetto gearbeitet und dafür ein Entgelt bekommen habe. Die Kommunikation fand zumeist nur über Formulare statt. Etwa 90 % der Richter weisen die Klagen ab.
Anders verhielt sich hier Renesse. Er reiste mehrfach nach Israel, beauftragte Historiker mit der Erstellung von Gutachten und machte sich durch persönliche Befragungen ein Bild von dem Leben im Ghettoalltag. Im Ergebnis sah er in 60 % der Fälle einen Anspruch auf die Rente, womit er stark von seinen Kollegen abwich.
Diese schienen genervt vom Engagement des Richter und verhinderten teilweise wohl auch Beweiserhebungen, so Renesse. Die Situation verschärft sich 2009, als das Bundessozialgericht seine Rechtsprechung änderte und nun auch jede Beschäftigung als Arbeit im Ghetto galt, bei der der „Arbeitnehmer“ die Wahl zwischen Hungertod und Arbeit hatte. Damit wird als Entgelt auch Brot und Suppe angesehen.
Die logische Folge war, dass tausende Anträge neu beurteilt werden mussten, was zu einer höheren Arbeitsbelastung für Renesses Kollegen führte. Alsann bat die Rentenversicherung Rheinland um ein Treffen mit den Richtern und bat, auf Wunsch der Behörden, ein halbes Jahr lang keine Ghettorenten-Verfahren zu verhandeln.
Renesse wertete diesen Vorgang als einen eklatanten Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip. Jede Woche stürben Kläger, eine besondere Art der Erledigung. Konsequent bearbeitete er weiterhin Akten und bekam dafür einen Vermerk in seiner Personalakte: „Verursacht Reibungsverluste“, Fachjargon für Ungehorsam.
Im Jahr 2010 versetzt man ihn schließlich in einen anderen Senat. Als er sich deswegen an die Presse wendete, wurde er von der Präsidentin des Landessozialgerichtes ermahnt. Deswegen klagte er vor dem Richterdienstgericht wegen der Verletzung seiner richterlichen Unabhängigkeit, seine Klage wurde aber abgewiesen.
Mittlerweile saß er im kleinsten Zimmer ohne funktionierende Heizung und beklagte sich über Mobbing. Das Justizministerium sah keinen Anlass einzugreifen. Bereits 2007 wandte Renesse sich an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, schlug eine Pauschalzahlung, sowie einen monatlichen Betrag vor, die vom Ministerium wegen Unwirtschaftlichkeit abgelehnt wurden.
Als Renesse sich an die Anhörungsstelle für Holocaust-Überlebende im israelischen Finanzministerium wenden wollte, wurde ihm dies durch das Justizministerium untersagt. Das Versagungsschreiben ist aus ungeklärten Gründen in die Hände der Rentenversicherung, um die es geht, gelangt. Es ist von einem der Vorgesetzten Renesses – Joachim Nieding vom Landessozialgericht in Essen- unterzeichnet, der damit unmittelbar in den gescheiterten Einigungsprozess involviert ist.
Letzten Endes wandte der Richter sich im Jahr 2012 mit einer Petition an den Bundestag. Er forderte die rückwirkende Zahlung von Ghettorenten, beschwerte sich, dass den Holocaust-Überlebenden kein faires Verfahren zuteil wurde, da es schlicht und ergreifend an einer Anhörung gefehlt habe. Diese Petition stieß eine Änderung des Gesetzes zugunsten der ehemaligen Ghettoarbeiter an.
Die Überlebenden erhalten hohe Nachzahlungen, ein großer Teil der Kläger ist jedoch in der Zwischenzeit verstorben- so auch Kurt Eichhorn.
Während nur knapp die Hälfte der Antragsteller die Rente bekommt, leitete Justizminister Kutschaty ein Disziplinarverfahren gegen Renesse ein. Es geht um die Äußerung in einem Brief, dass in der Justiz Absprachen getroffen werden, um bewusst Holocaust-Überlebenden zu schaden.
Das Treffen der Richter wurde durch ein Richterdienstgericht bewertet, welches die Auffassung vertrat, dass kein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit vorliegt. Andere Ansicht vertretbar. So besagt Peter Pfennig, der Sprecher der Fachgruppe Gewaltenteilung in der „Neuen Richtervereinigung“ ist, dass auch der Zeitpunkt einer Sachentscheidung inhaltlich ist und deswegen nicht abgesprochen werden dürfe.
Dass nun gegen Renesse vorgegangen wird, bezeichnet er als ein Armutszeugnis der Justiz. Auch der Prozess läuft schleppend seit nunmehr vier Jahren.
Während es am 10. März noch hieß, man wolle eine gütliche Einigung bis zum 19. April, ansonsten gebe es eine „ultra petita“, sind diese Einigungsgespräche mittlerweile vom Tisch und ein neuer Gerichtstermin am 13. September angesetzt. Damit ist nicht nur eine lange Wartezeit verbunden, sondern die Möglichkeit zahlreicher Sanktionen eröffnet worden, von einer Geldstrafe bis hin zu einer Suspendierung aus dem Richterdienst.
Dieser Fall stimmt nachdenklich. Ein Richter, der sich für Gerechtigkeit einsetzt und dem scheinbar Steine in den Weg gelegt werden. Verfahren, die nicht verhandelt werden, Kläger, die in der Zwischenzeit sterben. Kläger, die zu seiner Zeit unsägliche Qualen erlitten haben und nun durch Formulare in einer fremden Sprache abgespeist zu werden scheinen.
Eine genaue Beurteilung der Situation ist nie möglich, schließlich gibt es immer mindestens zwei Seiten der Medaille, jedoch regt sich auch in einem Juristen, der schon während seinen ersten Semestern lernt, dass Recht und Gerechtigkeit nur eine geringe Schnittmenge haben, ein Gefühl der Ungerechtigkeit.